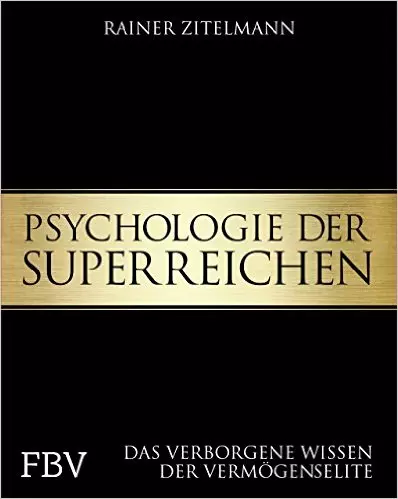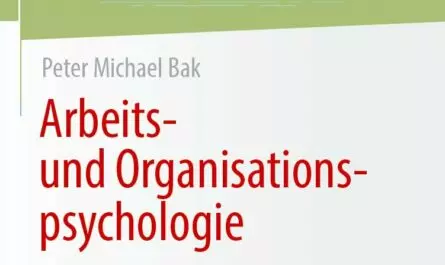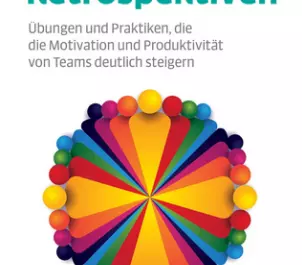REZENSION: Rainer Zitelmann: Psychologie der Superreichen: Das verborgene Wissen der Vermögenselite. FinanzBuch Verlag 2017
Armutsforschung gibt es schon lange und reichlich. Weniger, aber immer noch facettenreich, wurde die Zielgruppe der Top-Führungskräfte untersucht. Doch auch wenn in der Gesellschaft – dazu regelmäßig höchst emotional – das Thema „Manager-Gehälter“ diskutiert wird, bleibt dabei ein Element meist unbeachtet: Selbst die [aktuell vielgescholtenen und tiefgefallenen] Herren Winterkorn und Schrempf können sich am Ende ihres Vorstandsvorsitzes bei VW respektive Daimler-Benz nicht zur Kategorie der „Superreichen“ zählen. Denn in diesen Kreis kommt man[n?] in aller Regel nur als selbstständiger Unternehmer und nicht als Angestellter, selbst aus den Vorstandsetagen.
Allerdings wurde die Gruppe der „wirklich Wohlhabenden“ bislang nur minimal wissenschaftlich betrachtet. Dies liegt mit Sicherheit unter anderem daran, dass viele Mitglieder das Licht der Öffentlichkeit eher scheuen [wie aktuell das Verfahren rund um Anton Schlecker und seine Familie zeigt]. Rainer Zitelmann, beruflich selbst sehr erfolgreich und dadurch „steinreich“ geworden, kommt nun das Privileg zu, mit 49 deutschen Superreichen (teil-)standardisierte Interviews geführt zu haben. Dies erfolgte dann im Rahmen seiner zweiten Promotion unter konsequenter Wahrung der Anonymität der Beteiligten. Seine Dissertation umfasste dann am Ende knapp 400 Seiten und wird mittlerweile als stattliches, ansprechend formatiertes Buch herausgegeben.
Die zentralen Erkenntnisse daraus zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass sich ein für die untersuchte Zielgruppe der „Superreichen“ leider kein so durchgängiges Profil ergibt, wie es zu hoffen oder gar „bequem“ wäre. Vielmehr muss [auch] dieser Menschenschlag als ausgesprochen „divers“ gelten. Ungeachtet dieser Prämisse ein paar eher zusammenhängende Erkenntnisse:
- 44 der 45 Befragten waren männlichen Geschlechts (fast alle mindestens 40, sehr viele davon zwischen 50-59 oder 70-79 Jahre alt).
- Alle verfügen über ein Nettovermögen von mindestens 10 Millionen Euro, das oberste Quartil mindestens (!) 300 Millionen, davon das Allermeiste selbst erarbeitet (damit fielen neben anderen „Söhnen“ auch die extrem reichen Frauen aus der Untersuchung heraus, die ihr Vermögen weitestgehend geerbt hatten).
- Viele, nicht alle hatten zwar eine ordentliche / gute Schul- und Universitätsausbildung, zeigten dort aber oft eher mittelmäßige Leistungen (keine „Überflieger“), und auch die vermeintlichen „Elite-Kaderschmieden“ brachten keineswegs besonders viele Hochvermögende hervor. Ein Drittel hatte sogar gar nicht studiert und jeder Siebente war dazu noch ohne Abitur.
- Viele, aber nicht alle, haben eine Affinität zu (Leistungs-)Sport – nebenbei deutlich ausgeprägter zu Individual- als zu Mannschaftssportarten – und auch die Bereitschaft, ausgewiesene Sportler im Unternehmen zu fördern, denn dies fördert die Zielorientierung samt der Fähigkeit, mit Niederlagen umzugehen.
- Viele, aber nicht alle, stammen ursprünglich aus der Mittelschicht, recht wenige aus der „upper-class“ und noch weniger aus Arbeiterfamilien
- Überproportional viele wuchsen in Selbstständigen-Haushalten auf und viele waren auch schon seit ihrer Jugend eigenverantwortlich unternehmerisch tätig, eher selten wurden mäßig bezahlte klassische „Schüler-“ und „Studentenjobs“ wahrgenommen.
- Viele, aber lange nicht alle, können als sogenannte „Misfits“ gelten: Diejenigen „schwierigen Charaktäre“, die für eine Angestellten-Karriere als zu rebellisch und unabhängigkeitsstrebend gelten.
Systematisch und ausführlich untersucht wurden dazu typische Persönlichkeitsmerkmale der Vermögenselite unter Zuhilfenahme des sogenannten „Fünf-Faktoren-Modells“ und einem dazugehörigen Fragebogen. Auch wenn die Zusammenhänge nicht übermäßig eindeutig sind, fallen im Mittel auf:
- Hohe Extraversion und Offenheit für neue Erfahrungen, wenig Neurotizismus = hohe emotionale Stabilität
- Besonders ausgeprägte verkäuferische Fähigkeiten im erweiterten Sinne (wobei viel mehr „Verkaufstalent“ samt Empathie und Erklären-Können als „angeborene“ Ursache angenommen wird, anstelle dies in der (Hoch-) Schule mühsam erlernt zu haben)
- Hoch ausgeprägter Optimismus samt beachtlicher Resilienz (= Fähigkeit, Rückschläge zu verarbeiten und „abzuhaken“) sowie deutliche Selbstwirksamkeitswahrnehmung („Ich hab‘ mein Schicksal selbst in der Hand!“)
- Deutliche Risikoorientierung (aber oft ohne ausgeprägtes „Draufgängertum“ und mit der Tendenz zu analytischen und nur eingeschränkt intuitiven Entscheidungen („Bauchgefühl“)
- Gewisse, aber auch nicht durchgängig hohe Konfliktbereitschaft, zum Teil auch mittlerweile ein wenig „Altersmilde“ nach ruppigeren Jahrzehnten
- Klare Ziel- und Erfolgsorientierung.
Interessanterweise erkennen viele Hochvermögende im vielen Geld zwar die Möglichkeit, „sich schöne Dinge leisten zu können“, doch die Mehrheit findet diesen Punkt weder übermäßig wichtig noch ganz unwichtig (wie vermutlich der Rest der Bevölkerung auch). Allerdings wird die Freiheit und Unabhängigkeit durch den Reichtum schon (ehrlich) geschätzt.
Am Ende resümiert der Autor „Diese Dissertation hat gezeigt, dass die Annahme, alle Hochvermögenden würden über gemeinsame Persönlichkeitsmerkmale verfügen, ebenso gefehlt wäre wie die Annahme, dass es nur Unterschiede und wenige Gemeinsamkeiten gäbe.“ (S. 400). In diesem Sinne gelingt es Zitelmann sehr gut, oben umrissene Muster prototypisch aufzuzeigen und gleichzeitig die Spannweite seiner Erkenntnisse zu beleuchten. Neben einer wirklich sehr wissenschaftlich-sachlichen Arbeitsweise mit sauberen Begründungen der Methodik etc. gefallen neben den inhaltlichen Erkenntnissen auch die weiterreichenden Überlegungen, zum Beispiel, dass in solchen „Best-Practice Studien“ die Vielzahl derjenigen, die mit exakt den gleichen Eigenschaften [krachend] scheitert, nicht aufgeführt ist. Insofern bietet ein solches Profil keine Erfolgsgarantie, nur hat es halt bei einigen wenigen ganz offensichtlich gut funktioniert.
Allerdings greift dann die Gegenposition ebenso zu kurz, die ganz Reichen wären schlichtweg nur „zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen“, ihr Erfolg sei mehr oder weniger dem Glück oder Zufall zuzuschreiben. Denn zum einen muss der am Ende Erfolgreiche zunächst einmal in der Lage sein, besonders erfolgsversprechende Situation zu erkennen und dementsprechend zu handeln. Außerdem kann es – analog zur Spieltheorie – als extrem unwahrscheinlich angesehen werden, dass in ihrem Lebensweg die Superreichen immer nur Glück von außen hatten. Denn hier zeigt sich der Unterschied zum „Lottokönig“, die oftmals das rein zufällig erworbene Vermögen – anstelle es weiter zu vermehren – schon rasch wieder „durchgebracht“ hatten.
Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die wenigsten Dissertationen das Potenzial zum „Publikumsbestseller“ mit sich bringen, erhält der Leser des Buches ein kraftvolles Bündel an Kompetenz und Erkenntnissen zu einem sehr speziellen und interessanten Thema. Ungeachtet aller unbestreitbaren Wissenschaftlichkeit ist der Text gut zu lesen und auch dankenswerterweise passend zusammen gefasst. Die Analysen sind wohltuend sachlich-„unaufgeregt“ und für einen Historiker und Immobilieninvestor sehr „psychologisch“ und plausibel. Auch wenn es dem Rezensenten nicht gebührt, hat das Buch auch im MWonline-Kontext ein „Summa cum laude“ redlich verdient!