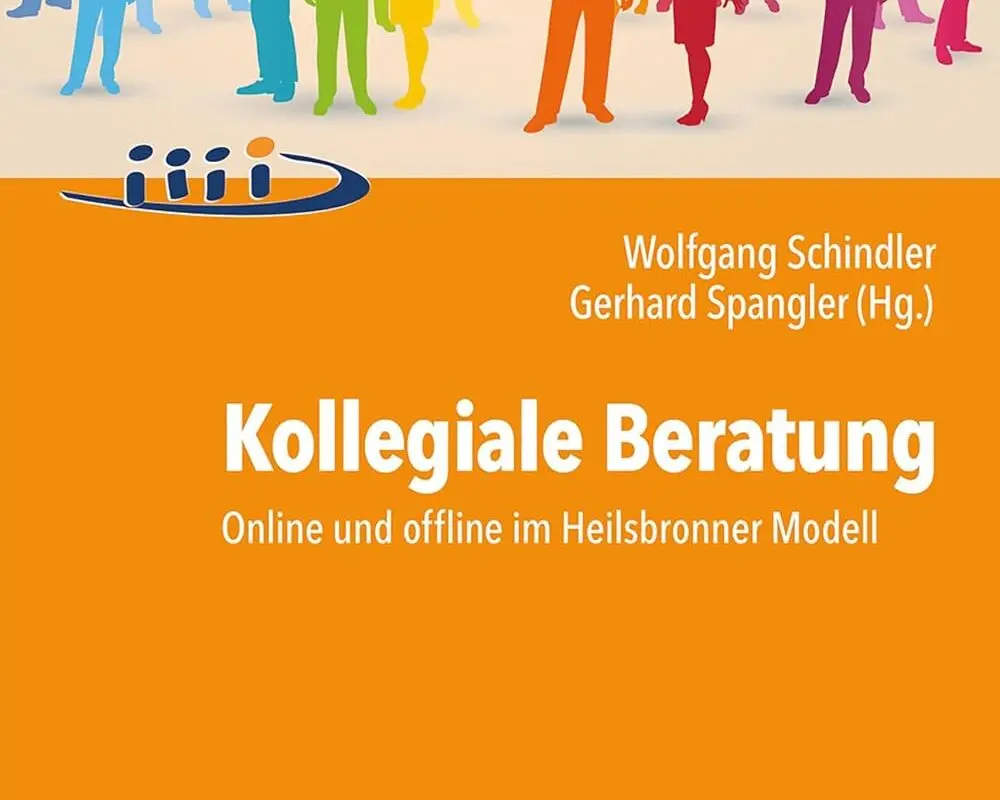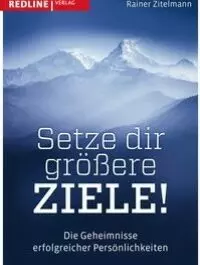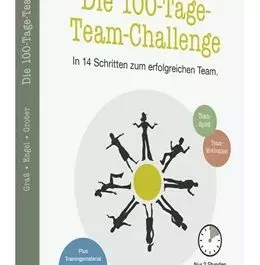REZENSION: Wolfgang Schindler / Gerhard Spangler (Hrsg.) – Kollegiale Beratung. Online und offline im Heilsbronner Modell. V&R 2022.
„Kollegiale (Fall-)Beratung“ kann auch als „Intervision“, „Kollegiale Supervision“ oder auf Englisch als „Peer-to-Peer Counseling“ bezeichnet werden. Das Grundkonzept der kollegialen Beratung ist schnell erklärt: Eine Gruppe von gleichberechtigen Kolleg(inn)en, also mehrere Personen, kommen gleichzeitig zusammen, um einen oder mehrere Fälle oder Anliegen aus dem beruflichen Kontext zu besprechen. Im Gegensatz zur üblichen Supervision erfolgt dies dann ohne externen Professionellen (= Supervisor), also selbstgesteuert. Damit ist die Gruppe umso mehr für Prozess und Ergebnis eigenverantwortlich. In diesem Setting sind dann üblicherweise drei Rollen vertreten:
Anzeige:

- Die Gesprächsleitung/Moderation
- Der/die Fallgeber(-in)
- Die Berater(-innen)
Grundsätzlich kann dieses Format in allen beruflichen Kontexten, also im Profit- ebenso wie im Non-Profit-Bereich, zum Einsatz kommen und sich dort bewähren.
Im Überblickskapitel wird zunächst ein Quervergleich vorgenommen, der vier Leitfäden zur kollegialen Fallberatung gegenüberstellt, dabei aber mehr Gemeinsamkeiten als fundamentale Unterschiede aufweist. Der hier im Buch vertiefte Ansatz beruht dann auf dem „Heilsbronner Modell zur Kollegialen Beratung“, das dann besonders ausführlich anhand von vier Säulen – Berufsbezug, Persönlicher Fall, Gruppe als Spiegel der Situation und Selbsterfahrung – behandelt wird. Neben systemischen „Spurenelementen“ stammen dabei die beiden Herausgeber sowie die meisten Autor(inn)en aus einem eher (sozial-)pädagogischen, psychoanalytischem Hintergrund.
Onlineberatung: Möglichkeiten und Grenzen
Besondere Aktualität gewinnt die Darstellung im Rahmen der abschließenden Einzelkapitel, in denen zunächst einmal Möglichkeiten und Grenzen der Onlineberatung diskutiert werden. Daraus ergibt sich dann die Möglichkeit eines digitalen Diskussionsforums statt eines gemeinsamen „analogen“ Gruppenraums. Aber auch kreativere Formate wie eine zeitversetzte, asynchrone Beratung – samt der damit verbundenen „Entschleunigung“ des Prozesses. Von den Gesamtproportionen des Buches her betrachtet werden allerdings solche innovativen Methoden nur ansatzweise beleuchtet. Dabei wäre die diesbezügliche Vielfalt und insbesondere glaubwürdige Praxiserfahrung damit sicher von besonderem Interesse gewesen.
Insgesamt handelt es sich um ein Buch von sicherlich ausgewiesenen Fachleuten für (angehende) Fachleute mit viel Interesse am Thema. Diese werden darin sicher die ein oder andere Anregung für ihr eigenes Tun finden [können]. Für ein breiteres Publikum kommt es allerdings weniger in Frage.