KRITIK: Ich liebe Artikel, die Mitarbeitenden empfehlen, wie man richtig mit dem eigenen Chef umgeht. Warum? Weil sie in der Regel einfach witzig sind. Unfreiwillig natürlich. Denn in den meisten Fällen sind die Tipps ernst gemeint. So vermutlich auch in diesem: Am Chef vorbei. Da berichtet ein IT-ler, der bei einer Versicherung arbeitete, wie er und sein Team unter einem zögernden und zaudernden Chef irgendwann anfingen, mit „U-Booten“ zu arbeiten. Projekte, die sie im kleinen Kreis „unter dem Radar ihres Vorgesetzten“ vorantrieben.
Warum? Weil es Situationen gegeben hatte, bei denen sie ein Sicherheitsproblem entdeckten und nachfragten, ob sie ein Programm sofort abschalten sollten. Der Vorgesetzte erbat sich Bedenkzeit, dann kam nichts mehr. Bis eine Cyberattacke das System lahmlegte. Die Metapher „U-Boot“ gefällt mir. Eine Studie zu dem Thema wäre sicher mal interessant: „Wie oft haben Sie schon mal ohne Wissen Ihres Chefs an einer Sache gearbeitet, weil Sie diese sinnvoll oder notwendig fanden, wohl wissend, dass Sie hierfür vermutlich nie oder erst mit langer Verzögerung die Zustimmung erhalten hätten?“
Anzeige:
Manchmal stecken wir fest: in der Zusammenarbeit, in Veränderungsprozessen, in Entscheidungs-Zwickmühlen oder in Konflikten. Dann kann Beratung helfen, die Bremsen zu lösen, um wieder Klarheit und Energie zu entwickeln. Wir unterstützen Sie mit: Führungskräfte-Coaching, Teamentwicklung, Konflikt- und Organisationsberatung. Zur Webseite...
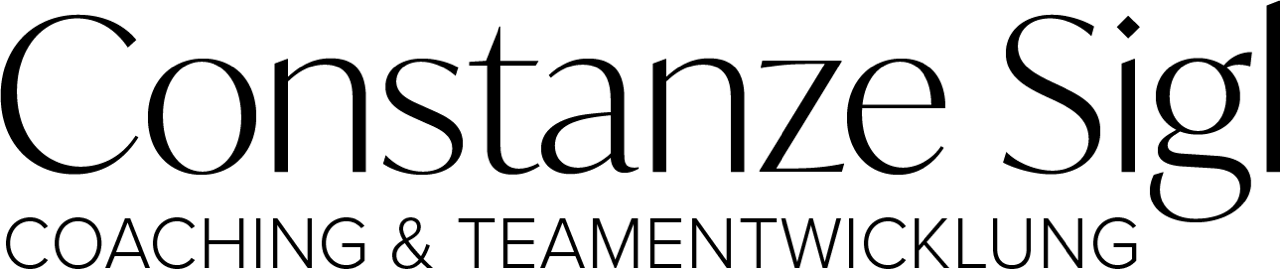
Und was passiert, wenn das Projekt dann fertig gestellt ist? Dann jubelt man es am besten der Führungskraft geschickt unter. Natürlich nicht, indem man zugibt, wochenlang daran ohne ihr Wissen getüftelt zu haben. Sondern so, als hätte man ganz zufällig und nebenbei eine tolle Lösung entdeckt. Verbunden mit der Frage, ob die Führungskraft diese nicht mal beim nächsten Abteilungsleitertreffen präsentieren wolle? Was diese dann mit Freuden macht und den Geniestreich seiner Leute preist.
Immer schön respektvoll
Die Tipps gehen alle in eine ähnliche Richtung: Statt um die Erlaubnis für ein bestimmtes Vorgehen zu fragen, mit dem man ein Problem lösen möchte, lieber Lösungen präsentieren. Dabei aber bitte nicht zu viele, das könnte den Chef überfordern. Also nur zwei oder drei, damit er die Wahl hat. Das ist wichtig, sonst hat er ja nichts zu entscheiden. Was ihm natürlich auch nicht gefällt, er will ja kein Erfüllungsgehilfe seiner Leute sein. Klar müsse sein, dass er stets das letzte Wort hat. Und wenn man die Vorschläge präsentiert, dann auf jeden Fall im Ton respektvoll, „um die hierarchischen Gepflogenheiten nicht zu verletzen“.
Noch ein „Trick“: Keine offenen Fragen nach dem Motto „Was halten Sie von dem Projekt?“ stellen (das könnte ihn schon überfordern, schätze ich). Sondern irgendwie das Gespräch geschickt auf schon vorhandene Beschlüsse lenken. Also zum Beispiel ein Meeting beginnen mit „Beim letzten Mal hatten wir ja schon festgelegt, dass … Nun müssen wir klären, ob wir …“. So kommt die Führungskraft hoffentlich nicht auf die Idee, alles noch einmal in Frage zu stellen.
Der witzigste Hinweis in dem Beitrag lautet: „Mitarbeiter können ihrer Führungskraft das Entscheiden nur erleichtern. Die Entscheidung manipulieren dürfen sie nicht.“
Alternative: Problem ansprechen
Schon klar, genauso läuft das häufig. Ein Problem der hierarchischen Ordnung. Kann man so hinnehmen. Aber man könnte auch das Problem ansprechen. Die Führungskraft mit ihrem Zögern konfrontieren und was das für die Mitarbeitenden bedeutet. Und sie fragen, wie ihre Vorstellungen lauten, um die Zusammenarbeit zu verbessern. Überall wird von Feedback gesprochen, aber hier wird empfohlen, die Führungskraft wie ein leicht beleidigtes Kind mit Samthandschuhen anzufassen.
Sie denken, dass sei keine gute Idee? Weil man sich damit nur Schwierigkeiten einhandelt und Konflikte heraufbeschwört? Kann natürlich sein, dann wird man irgendwann die Reißleine ziehen und das Unternehmen verlassen. Hat der hier zitierte IT-ler aber auch irgendwann gemacht – offenbar ohne zuvor zu versuchen, das Verhalten aktiv anzusprechen. Läuft also am Ende auf das Gleiche hinaus. Nur hätte die Führungskraft dann zumindest die Chance erhalten, mal in sich zu gehen.




