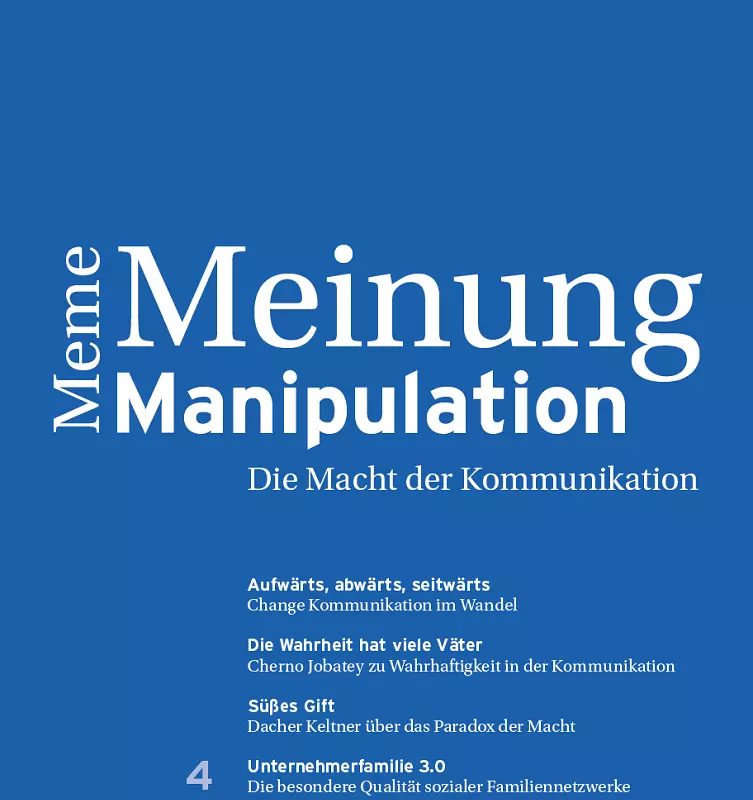INSPIRATION: Kennen wir alle: Jemand stellt eine Behauptung auf, wir glauben zu wissen, dass es eine Menge guter Argumente dagegen gibt und versuchen, sie zu widerlegen. Aber nichts hilft, wir stecken in einer Kommunikationssackgasse. Eine Ursache: Die „Eigengruppenbeweisführung“. So gefunden bei Michael Kang in der OrganisationsEntwicklung (Kommunikation in der Sackgasse). Kein neues Phänomen. Gemeint ist, dass man nur aus der Sicht der Gruppe argumentiert, zu der man sich zugehörig fühlt. Jedes Eingehen auf die Argumente des anderen werden als Angriff gegen die eigene Gruppe gewertet, und jedes Eingehen auf die Argumente des anderen als Verrat an eben dieser Gruppe.
In der heutigen Zeit ist das Phänomen noch dramatischer. Weil zum einen die Themen noch komplexer geworden sind, und deshalb gegen jede Behauptung zig andere angeführt werden können. Zum anderen weil man bei Google für nahezu jede Behauptung einen Beweis findet, egal, wie fundiert dieser auch sein mag.
Anzeige:
Bleiben Sie souverän und gelassen bei Konflikten in Teams und Organisationen!
In unserer Ausbildung Wirtschaftsmediation lernen Sie, wie Sie Konflikte konstruktiv klären. Fordern Sie jetzt unverbindlich das Infomaterial zur Weiterbildung an.
Ja, schickt mir mehr Infos!

Typische Merkmale
Typische Verhaltensweisen, an denen man eine Eigengruppenbeweisführung erkennt, sind:
- Man hält die eigene Story für komplex und differenziert, während man die der Gegenseite für simpel hält.
- Man behauptet, der andere verbreite gezielt die Unwahrheit, um seine Argumentation zu stützen, und nimmt dies als Rechtfertigung, es ihm gleich zu tun. Gut daran zu erkennen, wenn jemand alle möglichen Mängel an einer Darstellung aufzählt, ohne die Kernaussage in Frage zu stellen. Und weil eine Beweisführung natürlich nie 100%ig korrekt ist, findet man immer einen Mangel. Und schon ist der Beweis erbracht, dass der andere die Unwahrheit verbreitet.
- Man reduziert die Diskussion auf zwei Möglichkeiten. Und damit ist klar, dass der eine Recht und der andere Unrecht hat. Es gibt keine Alternativen.
- Der schon genannte Verrat an der eigenen Gruppe – wenn ich auf den anderen eingehe, muss ich befürchten, aus der eigenen Gruppe verstoßen, zum „Geächteten“ zu werden.
Wir oder die anderen?
Das macht schon sehr deutlich, dass es bei derartigen Diskussionen ein Aufeinanderzugehen nicht geben kann, es schlichtweg unmöglich ist. Typische Themen kennen wir alle: „Die Kriminalität bei Ausländern ist höher als bei Einheimischen.“ – „Der Klimawandel ist nicht vom Menschen verursacht.“ Und natürlich die gegenteilige Ansicht. Es gibt diese Diskussioen auch im Unternehmenskontext. „Nur mit ‚guten Produkten‘ lässt sich Profit erzielen, deshalb ist die Produktentwicklung das Wichtigste.“ – „Der Profit muss an erster Stelle stehen, sonst kann kein Unternehmen existieren.“ Und so weiter …
Obwohl er die Chancen eines gegenseitigen Verstehens für gering hält, stellt Kang Strategien vor, die uns in einer solchen Auseinandersetzung helfen könnten. Hier kommen sie:
- Nach einem tieferen Verständnis suchen. Also zum Beispiel den anderen zu bitten, mit uns gemeinsam danach zu suchen, was uns die scheinbar gegenteiligen Beweise zeigen. Nach dem Motto: Offenbar ist die Sache ja kompliziert, sonst wären wir uns schnell einig. Dann lass uns doch mal schauen, was hinter den so unvereinbaren Beweisen steckt und was das über die Realität aussagt.
- Von der Annahme ausgehen, dass sich der andere nicht vor der Gegenposition selbst fürchtet oder diese ablehnt, sondern vor ihrer ungesunden Version. Klingt kompliziert, sagt aber nichts anderes als wir es von dem Wertequadrat von Schulz von Thun kennen. Jede Wert hat einen Gegenwert und beide eine Übertreibung, die dann ungesund ist.
Bedeutet: Okay, wenn dir der Profit so wichtig ist, lass uns schauen, was für Vor- und Nachteile es hat, wenn dieser an Nr. 1 gesetzt wird. Und umgekehrt: Wenn ich die Produktentwicklung als das Wichtigste ansehe, lass uns prüfen, was daran problematisch und was vorteilhaft daran ist.
Raus aus dem Dilemma
Konkret stellt er sich das so vor:
- Man sucht die Vorteile beider Positionen, die größten Hoffnungen, die sich mit ihnen verbinden.
- Man sucht die Fallstricke, benennt die Ängste und Sorgen, die sich mit den gegenteiligen Positionen verbinden.
- Dann sucht man nach frühen Warnzeichen, die helfen, dass sich eine Organisation, eine Situation in eine der befürchteten Richtungen bewegt.
- Man sucht für den Fall, dass die Warnzeichen auftreten, mögliche Handlungsschritte, um dafür zu sorgen, dass die Befürchtungen nicht wahr werden.
Klingt gut, oder? Kang gibt zu, dass das Vorgehen für eine Diskussion über Polizeigewalt wohl eher nicht hilft. Die Strategien setzen ja voraus, dass man sich erst mal von der eigenen Position löst und in eine Metaposition geht. Nicht mehr danach sucht, wer Recht und wer Unrecht hat, sondern unterschiedliche Aspekte der eigenen Argumente betrachtet. Mich würde es allerdings schon reizen, es mal an einem solchen Beispiel durchzuspielen. Man stelle sich das in einer Fernsehdiskussion vor …