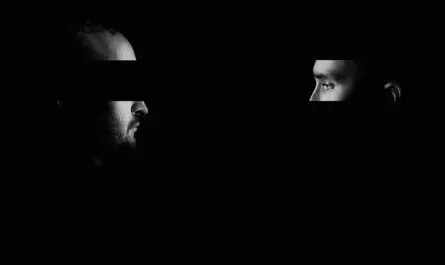KRITIK: Was tun, wenn Mitarbeitende im Change-Prozess negativ gestimmt sind? Vorbehalte haben, Bedenken vorbringen, vielleicht auch schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und dies nun im Weg steht, den Prozess beschwert?
Im Change-Management werden auch immer wieder Einzelinterventionen nötig. Zumeist wird man sie – im Rahmen einer Change-Architektur – Coaching nennen. Autor Marc Solga (Wise Interventions) rückt sie sogar in den pädagogischen Kontext. Eine Einschätzung, die man nicht teilen muss, weil damit zugleich eine hierarchische Kommunikation markiert wird. Insbesondere dann, wenn Berater:innen ungünstige Bedeutungszuschreibungen bei Einzelnen wahrnehmen, und die Vermutung haben, dass dadurch abwertende Interpretationsspiralen in Gang kommen.
Anzeige:
Seit mehr als 20 Jahren berate und begleite ich Mitarbeitende und Führungskräfte in Non-Profit-Organisationen, sozialen Einrichtungen, Vereinen und Verbänden bei individuellen oder strukturellen Entwicklungs- und Veränderungsprozessen. Zur Webseite...

Immerhin bezieht sich der Wirtschaftspsychologe auf wissenschaftliche Konzepte wie die Attributionstheorie, die Dissonanztheorie und die Self-Affirmation Theory. Andere würden pragmatisch das Reframing-Konzept bemühen. Doch die Gefahr, dass Reframing-Maßnahmen, hemdsärmelig angewandt, havarieren, ist nun nicht gerade gering.
Der Autor bezieht sich konkret auf zwei interessante psychologische Schulen: Die Positive Psychologie sowie die Akzeptanz- und Commitment-Therapie (ACT).
Menschliche Bedürfnisse
“Wise” übersetzt er übrigens mit “verständnisvoll”, was den hierarchischen Charakter der Kommunikation in meinen Augen etwas abmildert – oder verschleiert. Als Grundlage dient das altbekannte Motivationskonzept von Murray: Leistung, Autonomie und sozialer Anschluss. Das heißt, Leistung und sozialer Anschluss werden als Bedürfnisse bezeichnet, die Menschen antreiben. Dass nun gerade Autonomie hier ausgeklammert wird – “Für unseren Kontext ist dies aber weniger von Bedeutung” – erschließt sich mir nicht und lässt mich stutzen. Denn nun folgt die Erklärung, warum überhaupt diese “Wise Interventions” zum Einsatz kommen sollen:
- “In Beratungsprojekten beobachten wir immer wieder, dass Mitarbeiter*innen mit einem hohen Widerstand auf organisationale Veränderungsprozesse reagieren.” Und das, weil sie in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht haben. Der Widerstand basiert auf “einer Kränkung von Zugehörigkeits- und Anerkennungsbedürfnissen”. – Es soll das Involvement gefördert werden.
- Es soll zudem die Resilienz der Mitarbeitenden gestärkt werden. Denn diese werden durch Change-Maßnahmen beansprucht. Statt Frustrationen sollen “Aufwärtsspiralen zwischen Person und Umwelt in Gang gesetzt werden”.
Das klingt einerseits weise. Denn der kontraproduktive Umgang mit Widerstand – man müsse ihn bekämpfen, brechen gar – dieser Ratschlag ist leider immer noch zu hören (Grober Unfug). Und doch liest sich der Ansatz etwas halbherzig. Doch dazu später.
Zwei Vorgehensweisen
- Die erste Idee (Intervention) lautet, “aus der Reflexion von Enttäuschungen in die Reflexion persönlicher Stärken” zu kommen. Solga bezieht sich auf das Konzept der Signaturstärken aus der Positiven Psychologie (Positiv, selbstbestimmt und sinnvoll). Es sollen Ressourcen angesprochen werden. Und das weitere Vorgehen erinnert an die lösungsfokussierte Arbeit in der Tradition von DeShazer/Berg. Ein solcher Ansatz ist grundsätzlich sinnvoll.
- Die zweite Idee (Intervention) lautet, “aus der Reflexion von Erlebnisvermeidung in die Reflexion persönlicher Lebenswerte”. Das geht über die sogenannte ACT-Matrix. Diese gliedert sich in vier Aspekte: Unangenehme Erlebniszustände, Erlebnisvermeidung, Lebenswerte sowie Verwirklichung. “Dem ACT-Ansatz liegen kurz – und stark vereinfacht – gesagt folgende Ideen zugrunde: Die Dinge, die wir tun, um unangenehme Erlebniszustände zu vermeiden, verschaffen uns nur kurzfristig eine Linderung. Langfristig vergrößern sie unseren Lebensdruck, weil sie die eigentlichen Probleme unbearbeitet lassen und diese sogar noch verstärken, oder aber neue Probleme erzeugen, die wir erneut zu vermeiden versuchen.” Durch Reflexion auf die Lebenswerte von einer Metaposition aus soll sich eine positive Perspektive ergeben.
Fallstricke der Methode
Man muss dem Autor zugute halten, dass er selbst Einwände gegen sein Vorgehen vorträgt. Der erste bezieht sich auf die Basis: Solche Arbeit benötigt eine Vertrauensbasis. Ist sie nicht gegeben, wird sich erst recht Widerstand einstellen. Wir wissen aus der Coachingforschung längst, die Wirksamkeit bei “geschickten” Klienten ist deutlich reduziert. Wenn man mit Druck und serienmäßig ans Werk geht, wird man Reaktanz ernten. Der Autor leistet diesen Bedenken Vorschub, wenn er ein geskriptetes Vorgehen vorschlägt, von “leichter Hand“ spricht und auch definitiv ein Gruppensetting vorschlägt.
Daher ist zu unterstreichen, was der Autor selbst zu bedenken gibt: “‘Wise Interventions‘ sind affirmativ.” Rahmenbedingungen (Strukturen etc.) bleiben unberührt. Und sie können auch kein Ersatz für fundierte Kompetenzentwicklung darstellen.
So fragt man sich, warum diese Interventionen dann überhaupt dem Publikum präsentiert werden. Im übrigen erscheint das Vorgehen insgesamt recht einseitig kognitiv orientiert zu sein. Hier haben sich inzwischen Ansätze etabliert, die Emotionalität und Körperlichkeit integrieren (Embodiment und Emotionen). Dann sind wir allerdings definitiv im Coachingkontext unterwegs. Ohne die Freiwilligkeit des Klienten geht da nichts.