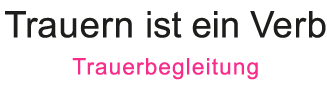INSPIRATION: Wenn es im Team nicht läuft, dann dürfte es in der Regel mit dem gegenseitigen Vertrauen auch nicht gut bestellt sein. Was sicher nicht nur für Teams, sondern auch für Partnerschaften, Geschäftsverbindungen, Familien – kurz: Für alle Arten von Beziehungen zwischen Menschen gelten. Um daran etwas zu ändern, sollte man „erst einmal die verschiedenen Arten von Vertrauen verstehen“ (Vertrauensfrage). Muss man wirklich?
Gibt es so etwas wie verschiedene Arten oder Dimensionen von Vertrauen? Der Begriff ist nicht so einfach zu definieren, oder? Ich vertraue einer Quelle – dann meine ich, dass ich darauf baue, dass die Quelle keinen Unsinn enthält. Ich vertraue dem Wetterbericht – dann setze ich darauf, dass eine Vorhersage eintrifft. Irgendwie geht es um Sicherheit in der Unsicherheit: Ich weiß etwas nicht, aber irgendwie gehe ich davon aus, dass das, was ich annehme oder glaube, zutrifft.
Besser kriege ich es nicht hin …
Hinter einer Quelle oder dem Wetterbericht aber stecken Menschen. Im Grunde setze ich also darauf, dass die Autoren oder die Meteorologen sauber gearbeitet, nicht geschludert oder gar wissentlich manipuliert haben. So wie ich dem Rat eines Arztes vertraue, der Zusage einer Kollegin, dem Versprechen meines Partners, der Empfehlung meines Finanzberaters …
Also geht es beim Vertrauen immer darum, dass der andere oder die anderen ihr Bestes geben? Dann lohnt es sich, dieses „Beste“ einmal genauer zu betrachten – wie in dem Beitrag von Michael Watkins. Er unterscheidet zwischen Vertrauen in …
… die Kompetenz – soll heißen: Ich gehe davon aus, dass die Kollegen das Wissen und die Fähigkeit haben, eine Aufgabe wie erhofft zu bewältigen.
… die Verlässlichkeit – dass sie sich darüber hinaus an Termine und Absprachen halten.
… die Integrität – dass ethisch einwandfrei handeln, sich z.B. an faire Entscheidungsprozesse halten.
… die Kommunikation – besser: dass sie offen und transparent kommunizieren, ihr Wissen teilen.
… die Flexibilität – dass sie ihr Verhalten anpassen, wenn es die Situation erfordert.
… geteilte Emotionen – dass sie sich den anderen wohlwollend und empathisch gegenüber zeigen und so für ein sicheres Umfeld sorgen.
Willkürliche Liste
Klingt etwas willkürlich, auf jeden Fall nicht irgendwie wissenschaftlich hinterlegt. Irgendwie amerikanisch. Ob ich wirklich darauf immer vertrauen muss, dass der andere flexibel handelt, hängt wohl vom Kontext ab. Und ob ich wirklich will, dass mein Kollege mir 100 %ig die Wahrheit sagt, lasse ich auch mal dahingestellt. Was ist mit Einsatz bzw. Engagement? Möchte ich nicht auch darauf bauen, dass meine Kollegen, wenn sie eine Aufgabe übernehmen, sich richtig reinhängen? In einer Sportmannschaft wäre mir das schon sehr wichtig.
Oder wie sieht es mit dem Vertrauen in die Diskretion aus? Möchte ich mich nicht auch darauf verlassen können, dass eben nicht alle Informationen transparent weitergetragen werden (Vertrauen verstehen)?
Mit anderen Worten: Man sollte diese Liste wie auch den dazugehörigen „Test“ nicht ganz so ernst nehmen. Dennoch könnte es sich lohnen, mal zu überlegen, was eigentlich gemeint ist, wenn es um fehlendes Vertrauen geht – egal ob in einem Arbeitsteam oder anderen Beziehungen. Das zum Thema zu machen stelle ich mir alles andere als leicht vor.
Nehmen wir mal die Beziehung zwischen Coach und Klient. Wenn der Klient seinem Coach nicht so ganz vertraut: Geht es hier um die Kompetenz? Um Diskretion? Um Einsatz für den Klienten? Um Integrität?
Wirklich die Vertrauensfrage stellen?
Mal auf ein Team angewandt: Ist es denkbar, dass man sich in die Augen schaut und verschiedene „Dimensionen“ von Vertrauen zur Sprache bringt? So zum Beispiel:
„Vertraust du mir in Sachen Kompetenz?“ Schon wird klar, dass diese „Dimension“ alles andere als einfach zu beurteilen ist. Die Antwort könnte lauten: „Ganz bestimmt, wenn es um Zahlen geht! Aber weniger, wenn es um das Verhandeln von Verträgen geht.“
Oder: „Vertraust du mir bezüglich meines Einsatzes?“ Antwort: „Ganz sicher bei allen Dingen, die spannend und abwechslungsreich sind. Aber weniger, wenn es um Routineaufgaben geht.“ Usw.
Mein Fazit: Es würde sich lohnen, die Vertrauensfrage zu stellen. Unbedingt. Aber dazu braucht man keine Liste oder Dimensionen. Einfach mal gegenseitig klären, wo das Vertrauen groß und wo es vielleicht weniger groß ist. Könnte zu spannenden Feedback-Gespräch führen. Aber auch zu manch einer Überraschung oder gar Enttäuschung.