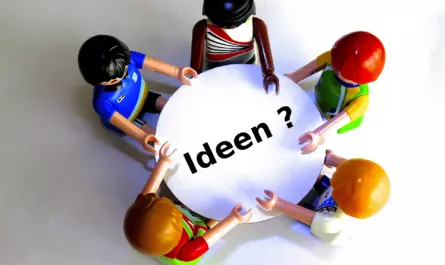INSPIRATION: Es gibt sie, die Weltmarktführer, die still und leise die Marktführerschaft errungen haben und ihre Position über lange Zeit halten. Gibt es Erfolgsfaktoren, die sie teilen? Und von denen man lernen kann?
Wie immer bei derartigen Fragestellungen darf man skeptisch sein, was die Übertragbarkeit sogenannter Erfolgsfaktoren betrifft. Andererseits üben sie schon eine gewisse Faszination aus, und zumindest sollte es erlaubt sein, diese mit den Gepflogenheiten im eigenen Unternehmen zu vergleichen und sich vorzustellen, was sich wohl ändern würde, wenn man ähnlich vorginge…
Nun denn, hier in Kürze einige dieser Eigenarten der Hidden Champions:
- Sie sorgen für Führungsnachwuchs aus den eigenen Reihen. Besetzen sie Führungspositionen mit externen Kandidaten, trennen sie sich von diesen rasch wieder, wenn Reibungen auftreten.
- Die Verweildauer der Unternehmensführer ist bemerkenswert lang. Sie beträgt 20 Jahre (zum Vergleich: In Großunternehmen sind es gerade mal 6,2 Jahre!). Das sorgt für Kontinuität und Verlässlichkeit.
- Tritt der Chef ab, ist der Nachfolger in der Regel deutlich jünger – was sich ja aus der Familiensituation ergibt. Allerdings trifft das auch dann zu, wenn der Kandidat von außen kommt. Was wiederum dazu führt, dass auch der Nachfolger sehr lange im Amt bleiben kann.
- Die Landesorganisationen werden von Managern geführt, die meist aus dem jeweiligen Land stammen. Das Top-Management hingegen ist selten international aufgestellt. Dafür ist dieses Gremium meist sehr klein und damit deutlich flexibler als ein großes Management-Team.
- Die funktionale Arbeitsteilung beginnt unterhalb des kleinen Führungsteams, wobei die Mitarbeiter ab der zweiten Ebene deutlich vielseitiger und für unterschiedliche Aufgaben ausgebildet sind. Was zur Folge hat, dass es häufiger Versetzungen zwischen Funktionen gibt.
- Der Führungsstil ist ambivalent. Das bedeutet: Die Unternehmensleiter sind autoritär, was die Grundwerte und Ziele des Unternehmens betrifft, aber partizipativ, was die operative Umsetzung angeht. Hier haben die Mitarbeiter weit weniger Regeln als in Großunternehmen und damit entsprechende Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten.
- Wenn sie wachsen, dann dezentralisieren sie konsequent. Bedeutet: Sie bilden Organisationseinheiten, die sich entweder an den Anwendungen der Produkte oder an den Zielgruppen ausrichten. Dabei nehmen sie in Kauf, dass es zu Doppelarbeiten und Kostennachteilen kommt, aber dafür der Kundennähe und der höheren Flexibilität zugute kommt. Matrixorganisationen werden möglichst vermieden.
Wie gesagt: Man kann trefflich darüber streiten, ob all das wirklich „Erfolgsfaktoren“ sind. Zunächst handelt es sich erst einmal um Beobachtungen. Die Frage könnte daher in der Tat lauten: Was würde passieren, wenn unsere Organisation sich hieran orientieren würde? Welche Wirkungen und welche Nebenwirkungen würden wir erzielen?