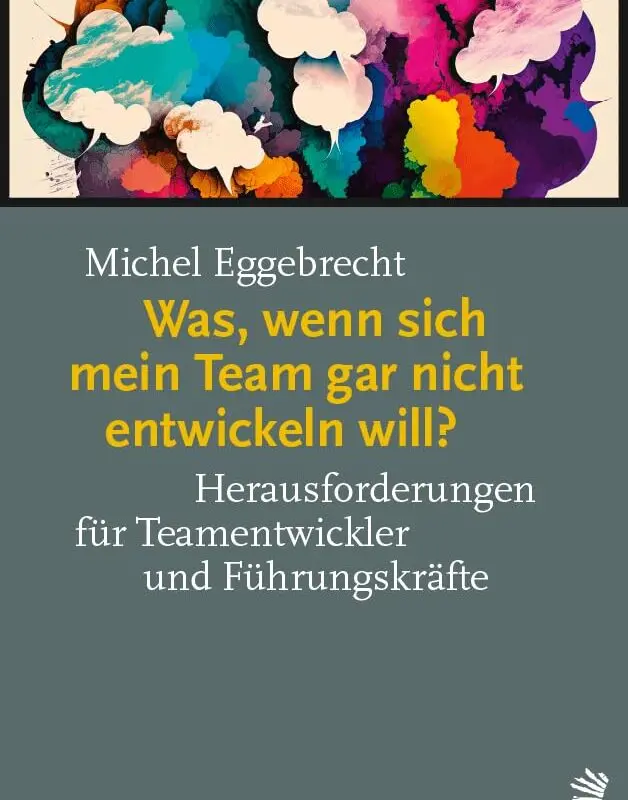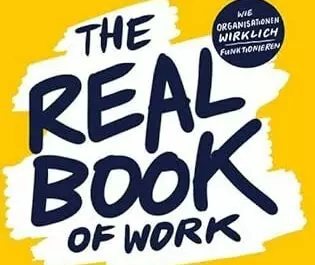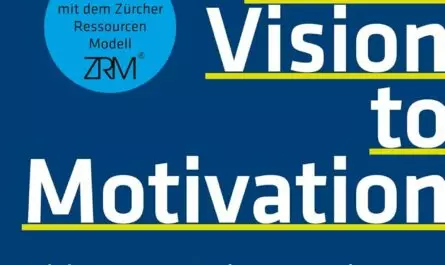REZENSION: Michel Eggebrecht – Was, wenn sich mein Team gar nicht entwickeln will? Herausforderungen für Teamentwickler und Führungskräfte. Carl-Auer 2024.
Wer mit dem Berufsleben einigermaßen vertraut ist, dem dürfte die Ausgangslage bekannt sein: Auch wenn sich in sämtlichen Mitarbeiterbefragungen der Wunsch nach mehr Personalentwicklung manifestiert, und in allen „Manager-Handbooks“ auf die Notwendigkeit von proaktiver Potenzialentwicklung hingewiesen wird, in der Realität funktioniert nun mal vieles nicht so, wie es wünschenswert wäre. Und wer nun mal vor genau so einer Herausforderung steht, dem soll mit diesem (Taschen-)Buch auf knapp 200 Seiten Text (ergänzt durch ein paar Abbildungen) geholfen werden.
Anzeige:

Die Zielgruppe wird schon im Untertitel deutlich – und auf den ersten Seiten wird dies weiter konkretisiert: Zum einen richtet sich das Buch an Führungskräfte, also an (disziplinarisch) Vorgesetzte, eine vergleichsweise klar definierte Rolle. Zum anderen richtet es sich aber auch an „Teamentwickler“, und das können neben Führungskräften auch Projektleiter, Personal(-entwickl-)er oder auch externe Berater/Trainer sein (natürlich auch in weiblicher Form).
Dabei stellt der Autor nicht ohne Grund zunächst die Frage, ob es in der – ab jetzt weit gefassten – Rolle als Teamentwickler seine Aufgabe ist, das „Mindset“ der Teammitglieder zu verändern. Denn dies stellt rasch ein besonders ambitioniertes Ziel dar, weil sich Einstellungen, Überzeugungen und Haltungen bekanntlich nicht leichterhand von außen ändern lassen. Daher plädiert er dafür, als Teamentwickler nicht in erster Linie den Menschen als solchen verändern zu wollen, sondern „nur“ die ihn umgebenden Spielregeln.
Auf welcher Seite stehst Du?
Dazu gilt es dann, die expliziten und impliziten Mechanismen der Gruppe zu durchdringen und dann entweder offensichtlich (= direktiv/top-down) oder eher „durch die Hintertür“ in die gewünschte Richtung zu beeinflussen. Wenn sich dabei erste und vermutlich unausweichliche Dilemmata abzeichnen, stellt sich rasch die Frage, auf welcher Seite der Teamentwickler steht: Auf der seines Teams und seiner Mitglieder oder der Organisation samt Geschäftsführung/Management?
Auch der passende Zeitpunkt ist von Relevanz: Ganz besondere Bedeutung kommt dem Anfang oder dem berühmten „ersten Eindruck“ zu. Aber auch gewachsene Fehlstellungen in der Teamstruktur können oder müssen im Zweifel korrigiert werden – gerade, wenn der Eindruck entsteht, dass sich das Team gar nicht entwickeln will; was der eigentliche Ausgangspunkt des Buches ist.
Weiter geht es dann mit Stichwörtern wie „Auftragsklärung“, in der verständlicherweise die Team- oder Selbstentwicklung bereits enthalten sein sollte. Oder „Für Veränderungen sorgen“, was dann insbesondere meint: „Wahre Ursachen erkennen und beheben, statt nur an Symptomen herumzudoktern“. Denn bekanntlich wird viel und bereitwillig über missliebige, aber oft unveränderliche Umstände gemeckert. Und wohlgemeinte Interventionen versanden regelmäßig. Dabei gilt es, das Zwischenmenschliche im Auge zu behalten und möglichst viel Augenhöhe untereinander zu ermöglichen, um psychologische Sicherheit zu ermöglichen. Weitere Stichwörter sind „Selbststeuerung fördern“ oder „Umgang mit Zeitdruck oder schwierigen Kollegen“, bis irgendwann das Ende des Projekts in Sicht kommt, was natürlich auch Auswirkungen auf die Teamentwicklung beinhaltet.
Und dann?
Wird das Buch damit seinem selbstgesetzten Anspruch gerecht? In gewisser Weise bestimmt, weil die Inhalte tatsächlich durchweg das thematisieren, was auf dem Deckblatt und dem Klappentext angekündigt wurde. Alles Geschriebene „stimmt“, und die meisten Leser werden sich bei der Lektüre an eigene Erfahrungen aus Berufsleben und Projektgeschäft erinnern. Andererseits bekommt der – durchaus wohlmeinende – Rezensent das Stichwort „Trockenschwimmen“ nicht aus dem Kopf: Genauso wenig, wie sich Schwimmen oder Radfahren durch Tutorials und äußere Anweisungen erlernen lassen, hilft auch die reine Lektüre des Buches über die Klippen des eigenen Alltags nur bedingt hinweg. An vielen Stellen macht der Autor deutlich, dass er sich insbesondere auf agile Arbeitsumgebungen, prototypisch die Software-Entwicklung im Rahmen von Projektteams, bezieht. Ein (recht knapp gehaltenes) Glossar erklärt die wesentlichen Begriffe wie „Scrum“ oder „Daily“.
Aber die Darstellung beschränkt sich ausdrücklich nicht auf dieses Arbeitsumfeld, und auch die Zielgruppe „Führungskräfte sowie andere Teamentwickler“ ist sehr weit gefasst. Damit wird die – wortreiche – Darstellung auch ein Stück weit beliebig. Zwar laden insbesondere die grau schattierten Textboxen mit den „Gedanken eines Teamentwicklers“ zur weiterführenden Reflexion ein oder die diversen „Fazits“ fassen das Gesagte kompakt zusammen. Aber der Leser bräuchte schon eine Menge Selbstdisziplin, bis er sich den Text als echter „User“ zu eigen macht und gezielt in sein eigenes Handeln überführt.
Dabei stellt die Ausgangslage in der Praxis eine Herausforderung dar und ist es wert, sich mit ihr zu beschäftigen. Anderseits wäre dazu möglicherweise – wie so oft – weniger mehr gewesen: Weniger Ausführungen, mehr Beispiele, weniger Breite, mehr Fokus. Aber allemal hat sich der Autor Michel Eggebrecht, als Wirtschaftspsychologe akademisch qualifizierter und zwischenzeitlich auch dort lehrender Unternehmensberater, wirklich sehr intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt und lädt aufrichtig dazu ein, seinen Überlegungen zu folgen und daraus in der Praxis selbst zu profitieren.