KRITIK: Seit der Buchveröffentlichung von Daniel Goleman ist „Emotionale Intelligenz“ ein populäres Konzept. Manche meinen, es sei bloß ein Buzzword, das zu viel verspreche – wie auch Künstliche Intelligenz.
Ehrlich gesagt habe ich mich immer schon schwer getan mit dem Konzept „Emotionale Intelligenz“ (EI). Entweder ist sie ein Intelligenzaspekt, dann passt sie nicht so richtig rein ins Gefüge der kognitiven menschlichen Fähigkeit zur Problemlösung. Denn da geht es vor allem um logische, sprachliche oder sinnorientierte Leistung. Aber das sehen einige hochrangige Forscher anders und erweitern den Intelligenzbegriff schon seit mehr als 30 Jahren.
Anzeige:
SOUVERÄN FÜHREN | FREUDE BEI DER ARBEIT | NACHHALTIGER ERFOLG. Mein individuelles Business Coaching entwickelt Ihre Führungskräfte gezielt: Klar werden für neue Denkansätze, Gelassenheit gewinnen, Herausforderungen bewältigen, überraschende Lösungen finden. Wie das geht? Warum mit mir? Erfahren Sie hier mehr …
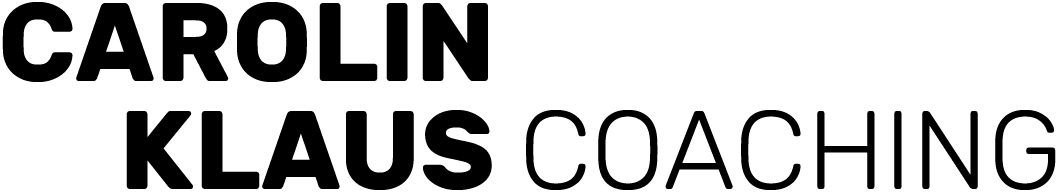
Oder es handelt sich um den intelligenten Umgang mit Emotionen. Dann wäre es für mich eine Kompetenz. Und damit wäre EI trainierbar, im Unterschied zu klassischen Intelligenzaspekten, die das deutlich weniger sind. Gemeint wäre also der Umgang mit den eigenen Emotionen, deren Wahrnehmung, Regulation und so weiter (Selbstkompetenz). Aber auch der Umgang mit den Emotionen anderer in der Zusammenarbeit (Sozialkompetenz).
Was ist Emotionale Intelligenz?
Die Autoren (Wie wichtig ist Emotionale Intelligenz und lässt sie sich beeinflussen?) knüpfen selbstverständlich bei der Veröffentlichung des Wissenschaftsjournalisten Daniel Goleman Mitte der 1990er-Jahre an, der das Thema jenseits der Wissenschaft gleich im populären Mainstream platzierte. Seitdem ist es ein Schlagwort geworden, das häufig undifferenziert gebraucht wird.
Seitdem sind zahlreiche empirische Studien und mehrere Metaanalysen erschienen, sodass man heute das Konzept seriös beurteilen und damit auch der Personalpraxis Auskunft geben kann, sagen die Autoren.
Was aber gleich auffällt: Es gibt nicht die eine Definition. „Kennzeichnend für das Forschungsfeld ist dabei nicht nur das Nebeneinander unterschiedlicher konzeptioneller Ansätze. Vielmehr adaptieren, erweitern und verändern wichtige Protagonisten ihre Definitionen und Messkonzepte im Zeitverlauf zum Teil erheblich.“ Da „wildert“ man auch schon mal gerne im Bereich Persönlichkeit oder Motivation.
Macht Emotionale Intelligenz erfolgreich?
Diese Frage ist schwierig zu beantworten, wenn die Definition unklar ist. Aber offensichtlich finden Metaanalysten positive mittelstarke Zusammenhänge von EI mit personalwirtschaftlichen Erfolgsgrößen. Solche „Hausnummern“ kennen wir auch aus der Forschung zu allgemeiner Intelligenz. Vielleicht sollte man daher den Spieß umdrehen und sagen: Intelligenz schadet nicht im Job. Wirtschaftlicher Erfolg hängt aber offensichtlich noch von weiteren Aspekten ab. Da kennen sich die Forscher aber weniger gut aus.
Ähnlich ist es beim Thema Persönlichkeit. Auch da hat die Forschung schon vor 20 Jahren positive Zusammenhänge mit wirtschaftlichem Erfolg im mittleren Bereich gefunden. Wer dann aber leichtfertig davon ableiten wollte, dass Extravertierte im Job erfolgreicher sind, hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Es kommt halt immer auf den Kontext an … Und man kann noch viel grundsätzlichere Kritik an solchen Rechenspielen vorbringen. Was machen wir mit einer Aussage wie dieser, dass die mittlere Tiefe der Gewässer in Deutschland 30 cm sei? So argumentierte seinerzeit Jürgen Kriz, der viele Jahre Professor für Statistik war, und Metaanalysen „Datenbelletristik“ nannte.
Eigenschaft oder Fähigkeit?
Nun wäre also noch zu klären, wie es um die Trainierbarkeit von EI steht. Auch hier bekommen wir einen positiven Wert kommuniziert: „Im Durchschnitt haben Interventionen mit d=0,45 einen signifikanten, mittelgroßen positiven Einfluss auf die gemessene Emotionale Intelligenz.“ Die Trainingsindustrie darf die Korken knallen lassen! Wobei das Werte sind, die PE-Maßnahmen ansonsten auch erreichen. Und jetzt kommt ein weiterer Dämpfer: „Leider erlauben die Untersuchungen keine detaillierteren Aussagen darüber, welche Art der Intervention (z. B. Feedback, Coaching, Diskussionsrunden) besonders effektiv ist.“
Was machen also Personaler:innen mit einem solchen Bericht? Ich würde mal sagen: Nicken, grinsen – und noch einen Kaffee zapfen. Oder? Eine abschließende gehässige Bemerkung kann ich mir einfach nicht verkneifen: In den Studien wurden auch positive Korrelationen mit „dienender Führung“ gefunden. Mit dem Konzept habe ich auch schon einmal ein Hühnchen gerupft (Weil wir uns alle lieb haben). – Aber jetzt mal weitergedacht: Was kommt dabei heraus, wenn man ein schlechtes Konzept mit einem anderen schlechten Konzept korreliert? Genau: Eine positive Korrelation. Glückwunsch!




