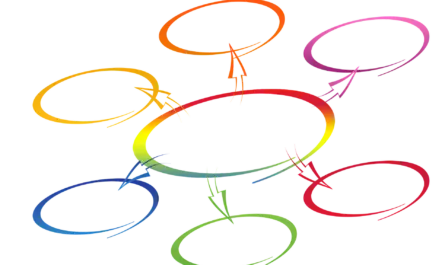INSPIRATION: Ein Dankeschön an die Brand eins. Es geht um Vorurteile, um überall verbreitete „Mythen“, die Menschen aktuell streuen und die häufig unwidersprochen hingenommen werden. Ein Ärgernis, also wird es Zeit, sie mal genauer unter die Lupe zu nehmen (Vorurteile schaden der Volkswirtschaft).
Da ist als erstes die immer wiederkehrende Behauptung: „Die Menschen in Deutschland arbeiten zu wenig.“ Tatsächlich sank die Wochenarbeitszeit zwischen 2019 und 2023 von 38,4 auf 34,3 Stunden – und ist damit im europäischen Vergleich eher niedrig. Allerdings hat sich in der Zeit die Zahl der Teilzeitkräfte mehr als verdoppelt, sie machen 30% der Arbeitenden aus. Das senkt natürlich den Schnitt. Die Vollzeitbeschäftigten arbeiten mit 40,2 Stunden nahezu genauso viel wie 1991 (41,4 Stunden).
Nr 2: „Die jungen Leute sind dauernd krank.“ Womit dann meist auch noch gemeint ist, dass die Generation X oder Z oder was auch immer wehleidig sei. Tatsächlich sind junge Menschen häufiger krank als ältere, das war aber schon immer so. Nur: Sie fehlen dann meist wenige Tage, während ältere deutlich länger ausfallen. Hinzukommt: Der Zahl der psychischen Erkrankungen hat deutlich zugenommen. Was an den vielen Krisen, aber auch daran liegen könnte, dass psychische Erkrankungen heute weniger tabuisiert sind.
Die jungen Leute von heute
Nr 3: „Die jungen Leute sind unmotiviert.“ Ihnen fehle die richtige Einstellung zur Arbeit und sie seien vor allem an ihrer Life-Work-Balance interessiert. Tatsächlich ist die Zahl der erwerbstätigen jungen Leute zwischen 2015 und 2023 überdurchschnittlich gestiegen, und zwar auf 76%. Was auch daran liegt, dass immer mehr junge Leute Nebenjobs annehmen, zum z.B. ihr Studium zu finanzieren. Dass die Generation weniger motiviert ist, stimmt übrigens auch nicht – im Gegenteil: die nach 1990 Geborenen sind deutlich stärker mit ihrem Arbeitgeber und ihrer Tätigkeit identifiziert.
Ein weiterer Mythos: „Frauen und Männer haben die gleichen Chancen“ – stimmt leider immer noch nicht. Zum einen arbeiten viel mehr Frauen in Teilzeit (50%, bei Männern sind es ca. 12%), zum anderen sind sie häufiger in Berufen mit niedrigeren Gehältern tätig. Und selbst dort, wo sie vergleichbare Tätigkeiten ausüben, besteht noch ein Gehaltsunterschied von 6 Prozent.
Und überhaupt – die Flüchtlinge
Und schließlich: „Zugewanderte liegen dem Staat auf der Tasche.“ Hier lauten die Zahlen so: Sieben Prozent der Geflüchteten, die zwischen 2013 und 2019 nach Deutschland kommen, fanden im ersten Jahr einen Job, nach drei Jahren liegt die Quote bei 34%, nach acht Jahren bei 68%. Das ist sicher optimierungsbedürftig, was u.a. aber auch mit bürokratischen Hürden zu tun hat. So dürfen Asylsuchende erst nach drei bis sechs Monaten arbeiten.
Wer also in Zukunft solche Sätze zu hören bekommt, kennt nun die passenden Antworten. Bitte weitersagen!