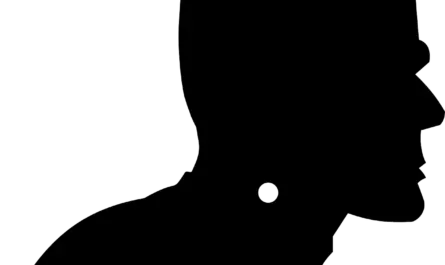PRAXIS: Natürlich ist jeder zunächst selbst zuständig für die eigene Gesundheit, aber wer sich in einem Angestelltenverhältnis befindet, der hat hierzulande einen Anspruch darauf, dass sich auch sein Arbeitgeber kümmert. Das gilt auch für psychische Belastungen, die müssen laut Paragraf 5 des Arbeitsschutzgesetzes systematisch erfasst und bewertet werden.
Und was können Unternehmen ganz praktisch tun? Die folgenden Tipps stammen aus Beiträgen der Brand eins mit dem Schwerpunkt „Mentale Gesundheit“ und sind lediglich Anregungen, die vielleicht weitere Ideen anstoßen. Es geht vor allem darum, dass es durchaus hilft, wenn wir uns eben doch um andere kümmern – „Common Care statt Selfcare“.
Anzeige:
Menschen mögen - Gesund führen - Fehlzeiten senken: Das sind die Themen von "do care!" Meine Materialien und Ausbildungen richten sich an Profis, die mit Führungskräften arbeiten - ob im BGM, im HR oder in Training und Beratung. Zur Webseite...

Präventionsideen
- Ein Buddy-System, bei dem für jede Aufgabe immer zwei Personen zuständig sind. Ist eine krank oder im Urlaub, springt die andere ein, damit muss niemand in diesen Zeiten weiterhin erreichbar sein.
- Jeder Mitarbeitende bekommt eine Vertrauensperson zur Seite gestellt, mit der er sich austauschen kann, um dann gemeinsam zu überlegen, was unternommen werden kann (Rückendeckung).
- Ein jährliches Gesundheitsbudget, so wie es Reyher seinen Mitarbeitenden zur Verfügung stellt. 600 Euro hat jeder zur Verfügung, sie werden genutzt z.B. für Vorsorgeuntersuchungen, Zahnreinigung, Trainingsprogramme oder Sonnenbrille mit Sehstärke.
- Austausch von Erfahrungen fördern, wie dies eine Studie bei Novartis nahelegt: Wenn Menschen ihre Erfahrungen mit Hilfsangeboten in Sachen psychologischer Unterstützung mit anderen teilen, sind diese eher bereit, ihre Hemmungen zu überwinden.
- „Kunst auf Rezept“ heißt eine Initiative in Bremen. Menschen mit leichten psychischen Beschwerden schreiben, singen, malen zusammen oder spielen Theater. Das ersetzt keine Therapie, aber hilft gegen Stress und Einsamkeit.
- Mehr Mitspracherecht zum Beispiel in Sachen „Teilen“. Gemeint ist nicht nur flexible Arbeitszeit, sondern flexible Zusammenarbeit. Beispiele sind geteilte Führungspositionen, Job-Rotation, Rollen auf Zeit je nach Projekt und Aufgabe. Auch mehr Flexibilität in Sachen Weiterbildung – statt starrer Programme schauen, was der Einzelne benötigt.
- Lüften – Feinstaub erhöht das Risiko einer Depression.
- Das Recht auf Nicht-Erreichbarkeit – da gibt es verschiedene Möglichkeiten: Empfang und Versand von E-Mails auf Diensthandys am Abend unterbinden, E-Mail-freie Zeiten individuell vereinbaren, den Abbau von Überstunden auch durch private Aktivitäten während der eigentlichen Arbeitszeit (Behördengänge, Sport) ermöglichen (Wie wäre es damit?)
Moodsuits
Sehr beeindruckend ist die Idee, wie man für mehr Verständnis am Arbeitsplatz für psychische Probleme sorgen kann. Die Idee ist, mit technischer Unterstützung Menschen konkret erleben zu lassen, wie sich eine Panikattacke oder eine Depression anfühlt. Das kannte ich bisher nur bei physischen Einschränkungen – wenn man Menschen mit speziellen Kopfhören Frequenzen ausblendet und so Schwerhörigkeit vermittelt. Oder sie im Rollstuhl erleben lässt, wie es sich mit fehlender Barrierefreiheit lebt. Aber psychische Störungen?
Auch das geht, wie ein junges Beratungsunternehmen, das aus einem Semesterprojekt hervorging, zeigt und inzwischen erfolgreich in Unternehmen einsetzt. Sie nennen ihre selbst entwickelten Objekte „Moodsuits®“, mit Namen wie „Beuger“, „Würger“ oder „Glocke“. Wer sie trägt, macht ganz neue Erfahrungen.
Was das bringt? Nehmen Sie mal an, Sie werden durch einen solchen „Apparat“ gezwungen, den Kopf zu senken und können ihn nicht heben. Und dann sagt jemand zu Ihnen „Kopf hoch!“ Genau diese Erlebnisse vermitteln die Moodsuits®-Workshops. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Aha-Erlebnisse Empathie gegenüber Menschen mit Depressionen stärkt.
Auch spannend: Plakate setzen Unternehmen in der internen Kommunikation schon lange ein, und vermutlich ist ihre Wirkung begrenzt. Aber wenn man auf der Toilette sitzt und auf ein Plakat schaut mit dem Text „Für einige deiner Kollegen ist diese Toilette mehr als nur eine Toilette“, dann dürfte bei vielen die Neugier siegen und sie dazu animieren, den QR-Code zu scannen. Und dann hören sie den Bericht eines fiktiven Kollegen, der über sein Drogensucht erzählt. Im Fahrstuhl geht es um Panikattacken, in der Kantine um soziale Ängste.
Das Ziel? Vor allem Prävention. Das Wissen über psychische Erkrankungen, von denen inzwischen jeder vierte Erwachsene betroffen ist (Keine Angst vor Scheißgefühlen), wird erhöht und damit auch die Chance, dass man frühzeitig angesprochen wird. Oder dass die Bereitschaft steigt, selbst frühzeitig das eigene Problem anzusprechen. Und um Rückfallprävention. Dort, wo diese Problem offen thematisiert werden, sinkt die Gefahr für einen Rückfall.