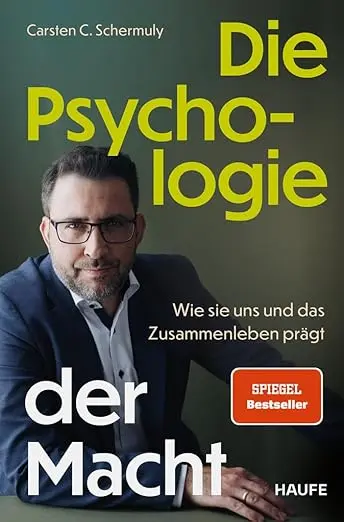REZENSION: Carsten Schermuly – Die Psychologie der Macht. Wie sie uns und das Zusammenleben prägt. Haufe 2025.
Macht ist ein faszinierendes Phänomen. Sie begegnet uns täglich: In der Gesellschaft, in Organisationen, im Privaten. Wann immer Menschen auf Menschen treffen, gibt es Abhängigkeiten. Weil der eine mächtiger ist als der andere. Und der andere sich eher ohnmächtig fühlt. Carsten Schermuly hat ein neues Buch geschrieben. Und wer sich noch nicht intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt hat, wird hier das eine oder andere Aha-Erlebnis haben.
Vorweg: Das Buch liest sich gut, ist flüssig geschrieben und bedient sich eines gefälligen Stilmittels: Viele Kapitel beginnen mit einem realen oder fiktiven Beispiel, das sofort neugierig macht auf die darauf folgende Theorie. Das Werk ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten geht es um die Frage, was Macht eigentlich ist, wie sie entsteht und was sie bewirkt. Wir lernen ihre Grundlagen kennen (Die Macht zu bestrafen, zu belohnen, legale und legitime Macht, die Expertenmacht und die charismatische Macht), welche Wirkungen und Nebenwirkungen sie auslösen.
Wir erfahren, warum die einen eher mächtig werden als andere (Wege zur Macht), aber auch, warum so einige Ansichten hierüber Unsinn sind. So haben es Psychopathen keineswegs leichter, an die Macht zu kommen. Auch wenn uns das durch prominente Beispiele so vorkommen mag. In die richtige Familie geboren zu werden, hilft dagegen ebenso wie die Tatsache, ein Mann zu sein.
Wie Macht uns verändert
Und wir lernen, was Macht mit uns macht (Die Metamorphose durch Macht). Wir genießen es, mächtig zu sein, neigen dann dazu, andere zu stereotypisieren und verlieren an Empathie. Macht korrumpiert und führt zu enthemmtem Verhalten. Alles Dinge, warum Macht keinen guten Ruf hat. Was bedeutet all das nun für jeden von uns?
Das wird in Teil 2 ausgeführt, wobei dieser zwar auch eine Reihe von wissenschaftlichen Quellen zitiert, aber im Wesentlichen Empfehlungen enthält, die dem Erfahrungsschatz oder Meinung des Autors entstammen. Für den Einzelnen geht es vor allem darum, sich selbst zu hinterfragen. Ein Gespür für Situationen zu entwickeln, wo er Macht ausübt oder Macht erfährt. Sich über die eigenen Machtmotive klar zu werden. Wachsam dafür zu sein, was Macht mit ihm anstellt. Und wenn wir Macht über (viele) andere haben, diese gezielt zum Wohle aller einzusetzen.
Zum Schluss werden Anregungen zum Umgang mit Macht auf der Organisationsebene gegeben. Für mich ist das immer der spannendste Teil, wobei ich mächtigen Menschen das Kapitel mit den Impulsen auf der Individualebene schon sehr nahelege. In Organisationen wird Macht zum einen im Organigramm festgeschrieben, aber jedem dürfte klar sein, dass dies die wahren Machtstrukturen nur unzureichend erfasst. Also wird empfohlen, eine Machtlandkarte zu erstellen. Mich würde hier interessieren, ob so etwas in der Praxis jemals eingesetzt wurde oder eher ein Wunschbild des Autoren ist.
Verteilte Machtstrukturen schaffen
Dann folgt der Tipp, die richtigen Menschen auszuwählen. Jene, die auch bisher verantwortungsvoll mit Macht umgegangen sind. Wie? Durch strukturierte Interviews, Arbeitsproben (Assessment Center) und Probezeit. Witziger Tipp: Bei jedem Positionswechsel eine Probezeit einführen – auch hier die Frage, ob es das schon irgendwo gibt.
Und schließlich die Empfehlung, verteilte Machtstrukturen zu schaffen. Also keine flachen Hierarchien, sondern Strukturen, in denen die Menschen vor Ort selbst entscheiden können, wie die Macht verteilt ist. Darunter z.B. auch die Idee, dass Teams durchaus entscheiden können, jemanden zum Chef zu ernennen, der dann wiederum Macht über sie hat (Leadership on demand). Weil das in großen Organisationen schwieriger ist, gibt es hier andere Tipps, z.B. die der Empowerment-Inseln. Dass Mitarbeitende etwa 4/5 ihrer Zeit in der klassischen Hierarchie arbeiten, ein Fünftel jedoch selbstorganisiert in Projekten an Prototypen arbeiten.
Kultur des Machtverzichts?
All das läuft jedoch darauf hinaus, dass diejenigen, die zunächst umfangreiche Macht besitzen (Unternehmer, Top-Manager, „Herrscher“), auf Macht verzichten. Und wir wissen ja, wie schwer Verzicht fällt, nicht nur beim Lebensstandard, sondern eben (und vielleicht noch mehr) beim Thema Macht. Bleibt am Ende vor allem der Appell: Machen wir uns bewusst, wo wir selbst Macht ausüben und ob das in Ordnung ist, und wo über uns Macht ausgeübt wird. Und lassen wir uns vor allem nicht verführen, in Krisenzeiten nach dem starken Mann an der Spitze zu rufen. „Überlassen wir die Macht autoritären Machthabern, dann bekommen wir sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zurück oder müssen sie uns unter hohem Aufwand und unter hohen Gefahren zurückerkämpfen.“
Eine „positive Kultur für den Machtverzicht“ zu schaffen oder gar „Machtverzicht mit Status“ zu entlohnen, scheint mir eine gewaltige Herausforderung zu sein. Denn nach wie vor huldigen wir der Karriere im Sinne von Aufstieg und bewundern die Mächtigen. Oder kann sich jemand einen Hollywood-Reißer vorstellen, in dem der Held dafür bewundert wird, dass er Macht abgibt?