REZENSION: Matteo Pasquinelli – Das Auge des Meisters. Eine Sozialgeschichte Künstlicher Intelligenz. Unrast 2024.
„Es wird der Tag kommen, an dem die gegenwärtige KI als Archaismus gilt, der als technisches Fossil neben anderen erforscht werden kann.“ Das Fazit des Autors zum Schluss seiner langen Expedition durch die Sozialgeschichte klingt markig – aber auch prophetisch. Da er aber tief und umsichtig in die Analyse der sogenannten KI einsteigt und deren Genese nachzeichnet, erscheint es zugleich plausibel. Denn die erste Erkenntnis, die man aus der Lektüre mitnimmt, ist vielen inzwischen längst bekannt: KI ist weder künstlich noch intelligent (Neuer Arbeitsethos). Der Begriff ist vielmehr eine Verschleierung und Tarnung: Es ist aber nicht drin, was draufsteht.
Anzeige:
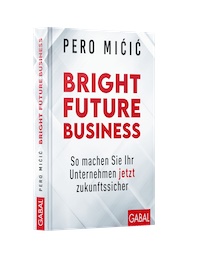 Machen Sie Ihr Unternehmen zukunftssicherer: Lesen Sie "Bright Future Business", das neue Buch von Prof. Dr. Pero Mićić. Erfahren Sie, welche acht Eigenschaften ein zukunftssicheres Unternehmen ausmachen und wie man sie als Masterplan für die Entwicklung des eigenen Unternehmens wie auch als Checkliste für Investments nutzt. Zum Buch...
Machen Sie Ihr Unternehmen zukunftssicherer: Lesen Sie "Bright Future Business", das neue Buch von Prof. Dr. Pero Mićić. Erfahren Sie, welche acht Eigenschaften ein zukunftssicheres Unternehmen ausmachen und wie man sie als Masterplan für die Entwicklung des eigenen Unternehmens wie auch als Checkliste für Investments nutzt. Zum Buch...
Die zweite Erkenntnis hängt damit zusammen und lautet: KI ist eine Kristallisation eines produktiven sozialen Prozesses. In dem die Arbeiterschaft unsichtbar gemacht wird (Ghost Work). Es sind nicht bloß die Heerscharen von Gig-Workern, die vor allem in Ländern des globalen Südens unter prekären Bedingungen die – oft genug im wahrsten Sinne des Wortes – Drecksarbeit erledigen (Gig-Work – eine Verzweiflungstat?). Es sind gleichwohl die Milliarden von Menschen wie Du und Ich, die schon lange und intensiv an KI mitwirken, ohne das vielleicht zu ahnen. Indem sie ihre Daten, mal gefragt, mal ungefragt den Datenmonopolisten überlassen.
Plattformkapitalismus
Das wirtschaftliche Szenario, in dem KI heute eine Rolle spielt, lautet Plattformkapitalismus. Und daher geht es um die „Wurst“, um eine politische Frage: Wollen wir das (weiterhin zulassen)? Oder nicht? Es greift zu kurz, einen Techno-Solutionismus gegen einen Techno-Pauperismus auszuspielen. Technik allein ist nicht schlimm, böse, gefährlich etc. Sie kann es aber in den Händen von Menschen sein. Und das zeigt, dass eine sozio-technische Analyse unerlässlich ist. Und nicht bloß der Blick auf die Technik.
Die bessere Frage lautet daher – ich spitze das mal etwas zu: Wollen wir als Sklaven der Datenmonopolisten leben? Oder wollen wir die Technologie für Freiheit, Gemeinschaft und Selbstbestimmung nutzen? Wenn Letzteres, dann müsste es um Dekolonisierung gehen. Denn KI, so das Fazit des Autors, hat uns längst kolonisiert (Überwachungskapitalismus). „Einer der problematischsten Aspekte der KI ist ihr epistemischer Einfluss auf die Gesellschaft, die Art und Weise, wie sie Intelligenz als eine maschinelle Intelligenz darstellt und implizit Wissen als ein prozedurales Wissen pflegt.“
Meister und Diener
Die eigentliche Gestalt der KI-Algorithmen ist soziale Intelligenz. Arbeit ist der erste Algorithmus, so der Autor, und er geht dafür zurück in die Jahre der industriellen Revolution: Die Entwicklung von Maschinen enteignete die Arbeiter. Ihr Wissen und Können wurden ihnen gestohlen. Man könnte daher die Arbeitsteilung (Kopf und Hand), die im Taylorismus zur vollen Entfaltung kommt, als die Ursünde betrachten: Die Mechanisierung des Algorithmus.
Hier kommen zwei Dinge zusammen: Eine neue Maschine kommt auf, um eine vorherige Art der Arbeitssteilung zu imitieren und zu ersetzen (Arbeitstheorie der Maschine). Und diese Arbeitsteilung ermöglicht es, zu kalkulieren, zu messen, zu überwachen (Prinzip der Arbeitskalkulation). Das Aufkommen der Informationstechnologien erscheint dem Autor somit „als Teil der langen Evolution der räumlich-zeitlichen Abstraktionen“. Die alte Einheit von Geist und Hand wird gekappt und beides separiert. Kohle statt menschlicher Muskelkraft erweist sich als die geeignetste Form abstrakter Energie. Hinzu kommt die radikale chronologische Strukturierung durch die Uhr.
Kybernetik
Der Paradigmenwechsel findet seit den 1940er-Jahren statt. „Genauso wie das Design der Industriemaschinen aus der Nachahmung der Arbeitsorganisation entstanden ist, kann man künstliche neuronale Netzwerke in vergleichbarer Weise als Maschinen betrachten.“ Der Think Tank an Forschern in den USA griff in den Kriegsjahren und danach auf die Gehirnmetapher zurück. Dabei stellte man sich Neuronen als telegrafische Relais vor. Der Traum von „denkenden Maschinen“ war in der Welt. Es wurden aber auch Anleihen bei der Biologie getätigt: zelluläre Automaten. Beide Metaphern hinken sehr (Beschränkt intelligent – KI als Zombie).
Neben den Namen John von Neumann und Karl Zuse wäre zahlreiche weitere Denker zu nennen, die sich nun um den Begriff der Selbstorganisation scharten. Heinz von Foerster selbstverständlich auch. Man schaue sich bloß ein altes Video mit ihm an. Da erläutert er so nebenbei die für maschinelles Lernen so wichtige Funktion der Mustererkennung (Tanz mit der Welt). Ein weiterer Name muss genannt werden: Friedrich Hayek. Der deutsche Ökonom nutzte das Paradigma der neuronalen Netzwerke dafür, die Marktwirtschaft mit dem Prinzip Selbstorganisation zu erklären und neoliberal zu stilisieren. Hayek behauptete, der menschliche Geist sei ein Classifier. Nicht nur durch Erkennen von Ähnlichkeiten definiere er Klassen, sondern er etabliere auch solche.
Deduktiv oder induktiv?
Damit ist eine große Kontroverse in der Entwicklung sogenannter Künstlicher Intelligenz benannt: Soll Intelligenz eine Darstellung der Welt sein? Dann müsste man deduktiv vorgehen und Expertensysteme nutzen (symbolische KI). Oder soll Intelligenz die Erfahrung der Welt „wie sie ist“ sein? Dann müsste man induktiv vorgehen mit Annäherungsmodellen (Konnektionismus). Die Erfindung des Perzeptrons durch Frank Rosenblatt im Jahr 1958 wird vom Autor als Meilenstein betrachtet. Diese Technologie ist ein statistisches neuronales Netzwerk zur Mustererkennung. Ein selbstorganisierendes Rechennetzwerk zur Klassifizierung von Stimuli in binärer Form. Eine Technik der mathematischen Optimierung. Im Grunde handelt es sich um eine automatisierte Version der Differentialrechnung. Deren inkrementelle Prozedur kann die Maschine schneller erledigen als ein Mensch. – Man versucht es also „von unten“, im Annäherungsmodus. Sarkastisch gewendet: Mein Dank wird Dir ewig nachschleichen, Dich aber niemals einholen.
Alles weitere ist Statistik. Es geht um dabei um statistische Trennbarkeit von Daten in einem multidimensionalen Raum. Das ermöglicht, nach Ähnlichkeiten zu ordnen. Künstliche Intelligenz ist statistische Intelligenz. Sie ist bloß eine Interpretationsmaschine (Simulation), der von ihren Usern „Denken“ attribuiert wird. Doch sie denkt nicht. In den Worten des Autors: Es wird das Theater der Menschen dem Menschen nachgestellt. Mit Intelligenz hat das wenig zu tun. Der Seitenhieb auf die Psychometrie und deren reduktionistische Intelligenzkonstruktion ist lesenswert! Intelligenz wäre demnach im Zusammenhang mit KI schlicht der falsche Ausdruck, besser wäre, von einer Wissenskonstruktion zu sprechen. Deshalb der messerscharfe Schluss des Autors: Intelligenz ist seinem Wesen nach ein sozialer Prozess.
Simulation und Halluzination
An dieser Stelle wäre es spannend, weiterzudenken. Was ist eigentlich Wissen? Der Blick auf die Wissenstreppe von Klaus North könnte da erhellend sein: Zeichen, Daten, Informationen, Wissen, Handeln, Kompetenz und Wettbewerbsfähigkeit als aufsteigende Treppe. Auf dem Weg nach oben schlägt Simulation leicht in Halluzination um. Autor Pasquinelli führt leider auch nicht weiter aus, was es bedeutet, dass Heerscharen von Gig-Workern aus den Ländern des globalen Südens dem Norden die Welt erklären/kategorisieren. Erhellend dazu das Video von Nicolas Gourault (Unknown Label) in der aktuellen Ausstellung im Kunstmuseum Bonn. Und was es macht, wenn überwiegend Material aus den Datenbeständen von Tech-Giganten aus den USA und China Trainingsgrundlage für KI-Anwendungen weltweit bilden: Führt das nicht zu einem neuen kulturellen Imperialismus?
Und was machen die User mit dem KI-Output? Inzwischen hört man schon Klagen von Führungskräften, die sich vom KI-Müll (sog. Slop), den ihnen ihre Mitarbeitenden anliefern, genervt fühlen. Und wie sicher gegen Manipulation sind die Systeme? Auch da hat man inzwischen schon Schlimmes gehört … Viele Fragen, auf die man gespannt Antworten bekommen möchte. – Und so realisiert man, dass beim Thema KI ein oder zwei Jahre Rezeptionsgeschichte schon eine längere Zeit darstellen.


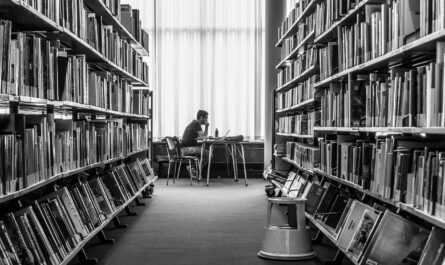

Der entscheidende Satz:
KI – es ist nicht drin, was draufsteht