INSPIRATION: Allerorten wird über die überbordende Bürokratie gejammert. Unternehmen und Verbände ziehen gegen sie zu Felde, und der einzelne stöhnt über jedes „amtliche“ Schreiben. Offenbar sind sich alle einig, aber ein Professor für Produktionsmanagement bricht eine Lanze für die Bürokratie (Regulierung ist eine Chance für Unternehmen). Weil, so die Argumentation, es immer wieder gesellschaftlichen oder politischen Druck braucht, um Dinge in Bewegung zu versetzen.
Wir erinnern uns an das FCKW in Kühlschränken und das Ozonloch. Oder ich weiß noch aus meiner Kindheit, dass man sich wenige Kilometer von mir zu Hause niemals an den Rheinstrand gelegt, geschweige seine Füße ins Wasser gelegt hätte. Die Unternehmen wussten sehr wohl, dass es auf Dauer nicht so weitergehen konnte – aber erst Regelungen und Vorschriften brachten sie zum Handeln. Und dazu, neue Ideen und Produkte zu entwickeln.
Anzeige:
Manchmal stecken wir fest: in der Zusammenarbeit, in Veränderungsprozessen, in Entscheidungs-Zwickmühlen oder in Konflikten. Dann kann Beratung helfen, die Bremsen zu lösen, um wieder Klarheit und Energie zu entwickeln. Wir unterstützen Sie mit: Führungskräfte-Coaching, Teamentwicklung, Konflikt- und Organisationsberatung. Zur Webseite...
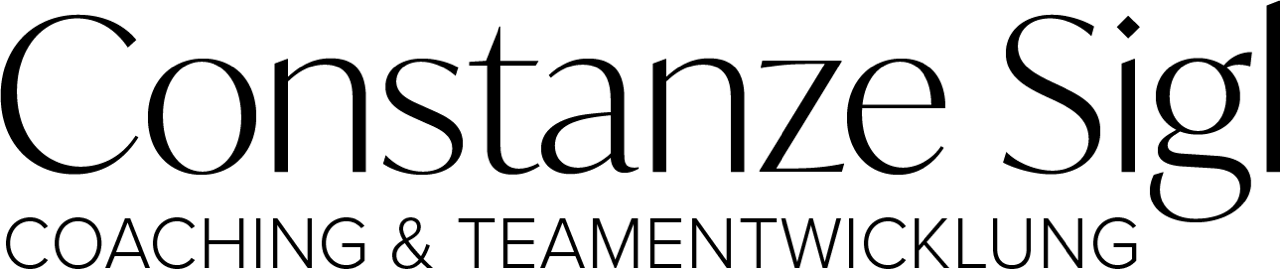
Ob bei Elektromobilität oder Frauenquote – erst wird gejammert und mit dem Verlust von Arbeitsplätzen gedroht. Oder erklärt, dass der Wettbewerb das schon richten wird. Oder man nehme den Arbeitsschutz. Auch lästig – aber möchte noch jemand in den Fabriken von vor 50 Jahren arbeiten?
Die drei Kinder der Bürokratie
Der Professor erklärt, dass die Bürokratie drei Kinder hat: Normen, Verwaltungsvorschriften und Berichtspflichten. Erstere sind freiwillige Standards, für die Unternehmen sogar dankbar sind. Es sind die „stillen Helden der Wirtschaft“, sie bieten Orientierung und machen das Wirtschaften leichter. Mehr noch: Sie sind Markteintrittsbarrieren für Produkte aus anderen Wirtschaftsräumen und machen den Wettbewerb fairer. Und irgendwann finden sie Eingang in Gesetze und sind damit verbindlich.
Die Verwaltungsvorschriften werden von Unternehmen ebenfalls geschätzt. Sie sorgen für Rechtssicherheit, machen aus Gesetzen praktische Umsetzungshilfen, z.B. als technische Richtlinien oder Umweltauflagen. Wohl dem Unternehmen, das in einem Land produziert, in dem es diese Sicherheit gibt – ein echter Standortvorteil.
Und da sind die Berichtspflichten, das ungeliebte Kind der Bürokratie. Sie mag niemand, nerven nur, halten auf, schlucken Ressourcen und Zeit. Über sie vergisst man häufig den Nutzen der beiden anderen Kinder. Ob alle sinnvoll sind, darüber kann man sicher trefflich streiten. Dass man viele vereinfachen und dabei die Segnungen der Digitalisierung nutzen könnte, ist wohl auch bekannt.
Aber was tun? Man kann Dienstleister engagieren, die sich angesichts der Flut von Berichten die Hände reiben. Die Behörden könnten so manche Regel auch entspannter handhaben, indem sie die Berichte nicht für jeden Einzelfall anfordert, sondern nur stichprobenartig. Man kann sich aber das Geschrei derjenigen vorstellen, die kontrolliert werden, während andere Glück haben.
Selbstreferenz par excellence
Oder aber man schaut sich erst mal im eigenen Haus um und kümmert sich um die selbstproduzierte Bürokratie. Dazu findet sich ein interessanter Beitrag im gleichen Heft (Zweckfreie Selbstbeschäftigung). Darin geht es um den eigentlichen Zweck von Unternehmen, laut Peter Drucker: „… to create a customer“.
Wenn man sich dann anschaut, womit sich Menschen in Unternehmen beschäftigen und diese Tätigkeiten dann bezüglich ihres „kundenschaffenden“ Beitrags hinterfragt, dann wird das Ausmaß der Beschäftigung mit sich selbst offensichtlich. Schönes Beispiel: Die Berechnung und Ausschüttung von Boni, die an unternehmensinterne Ziele gekoppelt wird, z.B. die Mitarbeiterzufriedenheit – „Selbstreferenz par excellence“.
Natürlich kann man immer argumentieren, dass jede interne Regel letztlich dabei hilft, dem Kunden zu dienen. Aber würde es wirklich schaden, wenn sie wegfällt? Hier ein Ausschnitt aus der Liste möglicher Maßnahmen – mit ganz witzigen Ideen:
- Man erstelle eine Liste mit Aufgaben, die das Team bearbeitet, weil eine interne Regel das vorgibt.
- Man priorisiere sie, indem diejenigen, vor der sich alle am meisten drücken, ganz oben auf der Liste stehen.
- Man untersuche sie bezüglich eines direkten oder indirekten Kundennutzens.
- Man prüfe, ob es jemanden gibt, den man fragen muss, bevor man die Aufgabe einfach weglässt.
- Man lasse sich probehalber einfach weg, oder bearbeite sie nur unvollständig (z.B. einen Bericht) und schaue, ob es eine Reaktion gibt.
- Man prüfe bei einer Aufgabe, die einen Mehrwert schafft, inwieweit man den bürokratischen Aufwand reduzieren kann, z.B. mit Abstrichen bei der Präzision.
- Bei Aufgaben, auf denen die Hierarchie weiter besteht, man aber den Kundennutzen nicht erkennt, hilft manchmal eine grobe Berechnung der Opportunitätskosten. Oder man wählt den dialogischen Ansatz und bringt diese Aufgaben in einen gemeinsamen Workshop ein.
Zwei-Brillen-Strategie
Und wenn dann immer noch gejammert wird über Vorschriften, deren Bearbeitung ach so furchtbar ist, dann hilft vielleicht das Coaching-Tool „Zwei-Brillen-Strategie“. Man bittet den Klagenden, mal richtig vom Stapel zu lassen, indem er die schwarze Brille aufsetzt und das Problem in den düsternsten Farben zu schildern. Mit Nachfragen wie: „Was sind die schlimmsten Folgen für uns?“ – „Wo bist du persönlich besonders geschädigt?“
Wenn ihm die schwarze Farbe ausgeht, bittet man ihn, die rosa Brille aufzusetzen mit der Einleitung: „Angenommen, die Sache hätte auch positive Seiten – für dich (Wie könnte dich das weiterbringen?) oder unser Unternehmen: Welche könnten das sein?“ Ein Vorgehen, dass jeder von uns vielleicht häufiger einsetzen könnte, wenn uns eine Aufgabe mal wieder ganz besonders gegen den Strich geht.



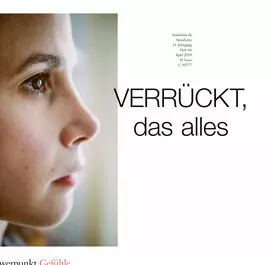

Die positiven Seiten der Bürokratie
1. Rechtssicherheit und Gleichbehandlung
Bürokratie sorgt für klare, allgemein geltende Regeln und Abläufe. So werden Entscheidungen nachvollziehbar und jeder Bürger wird gleichbehandelt.
2. Verlässlichkeit und Planbarkeit
Behördliche Prozesse folgen festen Strukturen. Das ermöglicht Planungssicherheit für Bürger und Unternehmen.
3. Schutz vor Willkür
Durch die Bindung an Gesetze werden individuelle Machtmissbräuche weitgehend verhindert.
4. Professionalisierung und Fachkompetenz
Amtsinhaber sind oft spezialisiert und qualifiziert. Das führt zu kompetenten Entscheidungen bei komplexen Fragestellungen.
5. Beständigkeit in Krisen
Gut organisierte Verwaltungen funktionieren auch in Krisensituationen, da ihre Abläufe unabhängig von Einzelpersonen sind.
6. Nachvollziehbarkeit
Prozesse und Entscheidungen werden dokumentiert. Bei Fragen oder Streitfällen lässt sich später nachvollziehen, wie und warum bestimmte Entscheidungen getroffen wurden.
Die Schattenseiten der Bürokratie
1. Übermäßiger Verwaltungsaufwand
Zu viele Formulare und Abläufe kosten Zeit und Nerven. Unternehmer wie Privatpersonen verlieren dadurch wertvolle Ressourcen, die produktiver eingesetzt werden könnten.
2. Trägheit und Innovationshemmung
Bürokratische Prozesse ändern sich langsam. Neue Ideen und schnelle Anpassungen an veränderte Bedingungen werden dadurch erschwert.
3. Intransparenz und Komplexität
Wer kein Experte ist, verliert leicht den Überblick über Vorschriften und Pflichten – das sorgt für Unsicherheit und Fehler.
4. Kostenfaktor
Der Verwaltungsapparat verursacht hohe Kosten. Diese werden durch Steuern oder Abgaben von Bürgern und Unternehmen getragen.
5. Frustration und Demotivation
Die Erfahrung, immer wieder gegen „Windmühlen“ ankämpfen zu müssen, mindert die Motivation und hemmt unternehmerisches Handeln.
6. Geringe Flexibilität
Maßgeschneiderte Lösungen sind selten möglich, da viel an festen Abläufen und standardisierten Prozessen hängt.
Worauf kann man verzichten?
Unnötige Doppelerfassungen und Mehrfachanträge
Überflüssige Nachweispflichten
Lange Bearbeitungszeiten ohne Grund
Unübersichtliche und widersprüchliche Vorschriften
Persönliches Erscheinen ohne sachlichen Grund, wenn digitale Lösungen möglich wären
Eine moderne Verwaltung setzt genau hier an: Sie vereinfacht Prozesse, digitalisiert Abläufe und baut Bürokratie da ab, wo sie nicht nötig ist.