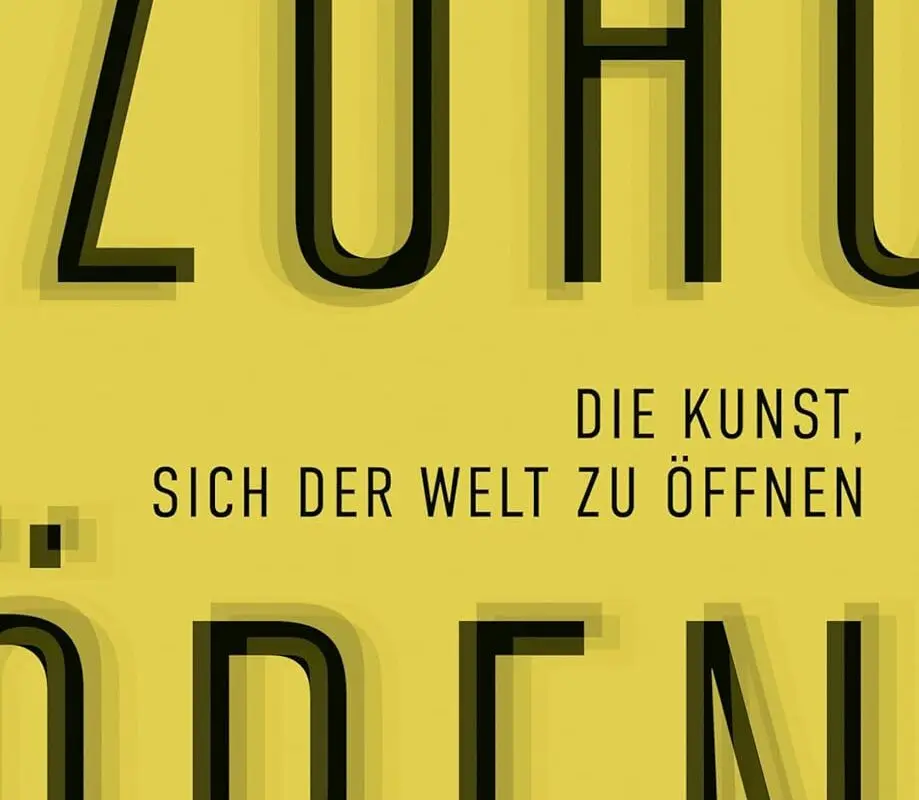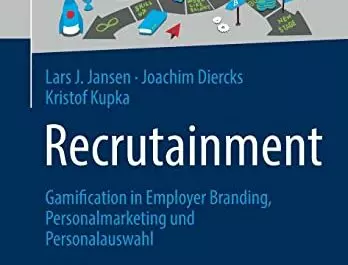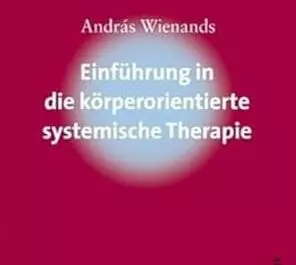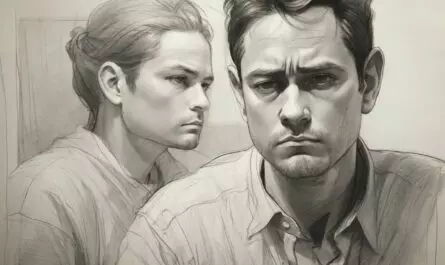REZENSION: Bernhard Pörksen – Zuhören. Die Kunst, sich der Welt zu öffnen. Hanser 2025.
„Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners,“ sagte weiland Heinz von Foerster. Autor Bernhard Pörksen, seines Zeichens Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen, hat – von Foerster ist schon über 20 Jahre tot – seinerzeit das Gespräch mit dem Mit-Gründervater systemischen Denkens geführt (Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners). Und die Reihe dann fortgesetzt: Mit Humberto Maturana, mit Friedemann Schulz von Thun … Sein neuestes Buch reiht sich stringent in diese Reihe, also in die Thematik, ein. Denn die offene Frage lautet: Warum hören wir uns nicht mehr gegenseitig zu? Was hindert uns daran? Und was wäre dann möglicherweise anders, besser vielleicht als derzeit?
Anzeige:

Pörksen geht es auch um eine Philosophie des Zuhörens. Aber viel mehr und länger interessiert ihn die Praxis. Dass Menschen weghören, überhören oder sich die Ohren verstopfen, mit Kopfhörern oder dem Alltagslärm der Geschäftigkeit, der Ablenkung, sich dem einlullenden weißen Rauschen hingeben. Denn was wäre, wenn sie einmal genauer hinhören, zuhören würden? Und betroffen wären, vielleicht sogar schmerzhaft? Wenn sie sich dann genötigt fühlen würden zu antworten? Wenn sie Verantwortung annehmen würden?
Taube Ohren
Die Beispiele, die Pörksen bringt, haben es in sich. Es beginnt mit der jahrelangen Missbrauchserfahrung von Schülern der Odenwaldschule und der Frage: Warum hat den Opfern niemand zugehört? Warum hat kaum jemand den Opfern Glauben geschenkt? Warum wurden stattdessen reflexhaft die Täter in Schutz genommen? Die nächste Etappe heißt Ukraine-Krieg: Der Vater in Russland weigert sich, mit dem Sohn in der Ukraine zu sprechen. Er zweifelt schlicht das Kriegsgeschehen an. Der Sohn baut mit Gleichgesinnten eine Website auf, um das Furchtbare zu dokumentieren und zugänglich zu machen. Irgendwann stoppen sie das Projekt: Niemand hört ihnen mehr zu – außer dem russischen Geheimdienst, der die Seite immer wieder attackiert. Die Ukrainer wechseln die Strategie und erzählen nun online von den schönen und lukullischen Seiten des Lebens in der Ukraine. Sie verweigern den Opferstatus.
Die nächste Station lautet Silicon Valley: Vom Hippie zum Magazin-Gründer zum Social-Media-Pionier – wie hält man die Kommunikation in einer Gesellschaft aufrecht, ohne sie dem Kommerz zu opfern? Und die letzte Etappe führt den Autor zum Thema Klimakrise: Wie kann es sein, dass die Weltbevölkerung die Augen vor der Katastrophe verschließt oder sie sogar verleugnet? Selbst wenn man von den Auswirkungen inzwischen selbst betroffen ist? Einfacher scheint es zu fallen, die Klimaaktivisten zu hassen, die sich auf Straßen festkleben, als das Notwendige zu tun und die Not zu wenden: Don’t look up!
Don’t look up
Pörksen zitiert Mona Neubauer, die Klimaaktivistin und aktuelle NRW-Wirtschaftsministerin: „Früher wurden große Verbrechen von bösen Menschen begangen (…). Heute wird das unbeschreibliche planetarische Verbrechen an unseren Lebensgrundlagen von Menschen begangen, die einfach nur ihre Träume verwirklichen wollen.“ Ich muss gestehen, das Zitat hat reingehauen, hat mich tief berührt, weil es einfach passte zu meinen eigenen Alltagserfahrungen – und auch zur Situation, in der ich das Buch Pörksens im Urlaub las: Während die einen alles versuchen, um die Katastrophe abzuwenden mit Recycling und der eigenen PV-Anlage auf dem Dach, hauen die anderen fröhlich auf die Sahne und feiern die „Nachspielzeit“ als ob es kein Morgen gäbe.
Wie kann es gelingen, dass wir uns wieder wirklich zuhören? Dass wir nicht nur das hören, was wir hören wollen? Statt unsere Meinungen und Vorurteile zu bestätigen, wäre es hilfreich, andere wirklich verstehen zu wollen; deren Motive hinter ihrem Verhalten zu erfahren. Vielleicht ergäbe sich die Gelegenheit zu entdecken, dass man bei vielen Zielen übereinstimmt; nicht aber im Weg. Das könnte der Anfang sein, gemeinsam zu überlegen, welche Alternativen es gäbe – statt sich gegenseitig „die Köpfe einzuschlagen“.
Da fällt mir diese kleine Anekdote ein, die Jürgen Kriz in seinem schönen kleinen Büchlein erzählt (Kleine Weiterbildung in Systemtheorie): Von den beiden auf dem Segelboot, das auf See ins Schlingern gerät. Woraufhin sich erst der eine, dann der andere sich aus dem Boot lehnt, um der Drift zu kontern. Und so lehnen sie sich immer weiter diametral aus dem Boot heraus …
Die Metapher vom Segelboot
Im dritten Teil seines Buchs beschäftigt sich Pörksen mit der Politik des Zuhörens. Und er zeigt ein Paradox auf: Nie war es leichter, seine Meinung kundzutun. Mit Social Media kann jede/r leicht senden und viele empfangen. Weil aber Unzählige zugleich senden, brabbeln, schreien und um Aufmerksamkeit buhlen, entsteht nicht nur ein riesiger Lärm. Sondern auch das Gefühl beim Einzelnen, dass man ihm nicht zuhört. Eine fatale Täuschung, sozusagen die Metapher vom Segelboot in groß.
Die Lösung würde so naheliegen: Deeskalation, langsam, Schritt für Schritt wieder ins Boot zurückgehen. Doch damit allein ist es nicht getan. Es müssten auch alle langsam, Schritt für Schritt den berühmten Gürtel enger schnallen. Hat das nicht sogar ein deutscher Bundeskanzler einmal gefordert? Das war in den 1980er-Jahren. Und wie ist die Geschichte weitergegangen? Das Florian-Prinzip lebt: Einer meint immer, er sei bisher zu kurz gekommen. Und wenn nicht hier, dann irgendwo sonst auf der Welt. „Un jeder möht ene Rolls-Royce hann, jeder!“ (Ruut-wieß-blau querjestriefte Frau), kann nicht die Lösung sein. Es führt uns bloß vor Augen, dass wir alle Teilnehmer*innen eines gigantischen Prisoner’s Dilemma sind: Wir spielen alle gegen die Bank. Und die sitzt immer am längeren Hebel.
Das End‘ vom Lied, das Autor Pörksen uns beschert, klingt versöhnlich. Aber wir wissen natürlich längst: Reden (und Lesen) reicht nicht: „Wirkliches Zuhören ist, so verstanden, gelebte Demokratie im Kleinen, Anerkennung und Akzeptanz von Verschiedenheit, Suche nach dem Verbindenden, Klärung des Trennenden, gemeinschaftliche Erfindung der Welt, die überhaupt erst im Miteinander-Reden und Einander-Zuhören entsteht.“ – Manchmal wirkt die Urlaubslektüre länger nach. Wenn das mal keine Empfehlung ist.