INSPIRATION: „Online“ geht auch, haben wir in Corona-Zeiten gelernt. Das Leben muss ja irgendwie weitergehen (Hape Kerkeling). Aber wie geht Führung im virtuellen Setting? Welche Rolle spielen dabei Körper und Geschlecht?
Man sieht nur sprechende Köpfe im TV-Polit-Sendungen. Die Unterkörper der Journalist:innen sind nicht zu erkennen. Der Name der Band, die sich 1975 gründete und bis 1991 bestand, war gefunden: Talking Heads. Und er war auch Programm. Denn in scheinbar naiver Weise ging es den Songs der Band um vermeintlich banale Themen. Diese wurden durch den nervös, hektisch und überspannt wirkenden Gesang von Frontmann David Byrne konterkariert. Die Band kultivierte das Lebensgefühl von Ambivalenz und Entfremdung.
Anzeige:
Manchmal stecken wir fest: in der Zusammenarbeit, in Veränderungsprozessen, in Entscheidungs-Zwickmühlen oder in Konflikten. Dann kann Beratung helfen, die Bremsen zu lösen, um wieder Klarheit und Energie zu entwickeln. Wir unterstützen Sie mit: Führungskräfte-Coaching, Teamentwicklung, Konflikt- und Organisationsberatung. Zur Webseite...
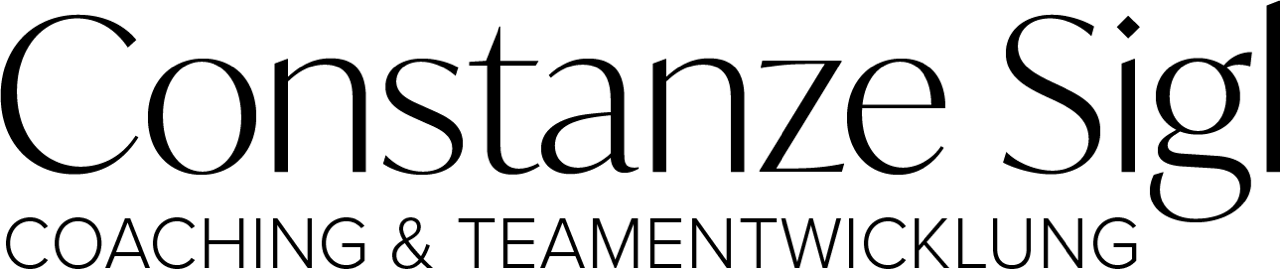
Eine spannende Fragestellung
Die Autor:innen („Und virtuell sind wir alle gleich!“) sind Expert:innen für Führung (Führung auf Distanz). Sie gehen der Frage nach, ob und „wie (…) sich die Wahrnehmung von Körper und Geschlecht im digitalen und physischen Raum (unterscheidet)“. Das darf man getrost als eine spannende und innovative Fragestellung bezeichnen. Einerseits geht es um die in Corona-Zeiten verstärkt aufgeworfene Frage, ob „online“ auch geht. Recht schnell wurde diese Frage seinerzeit allgemein bejaht. Das konnte man verstehen: Es musste ja irgendwie weitergehen.
Kritikerinnen – wie Elke Berninger-Schäfer, die sich schon vor der Pandemie mit Online-Kommunikation beschäftigt und auch eine eigene Online-Coaching-Plattform gelauncht hatte – drangen da kaum durch („Ich will aus meinem ganzen Repertoire schöpfen können“). Mit etwas Verzögerung, die Forschung zwangsläufig benötigt, haben sich inzwischen auch weitere Autoren zu Wort gemeldet und auf Probleme bei sowie hilfreiche Gestaltung von Online-Kommunikation hingewiesen (Online-Meetings). – Womit solche Best Practices aber noch lange nicht State of the Art wären.
Körper und Geschlecht
Doch die Autoren rund um Jürgen Weibler graben noch deutlich tiefer: Körper und Geschlecht. Den ersten Pflock, den sie in den Untersuchungsboden klopfen, hat den Titel: „Frauen, dies ist hinreichend belegt, sind in Führungspositionen unterrepräsentiert und auf dem Weg dorthin verschiedenen Formen der Benachteiligung ausgesetzt.“ Sie zitieren zusammenfassend den Ausspruch der Organisationspsychologie-Legende Ed Schein: „think leader, think male“.
Den zweiten Pflock bildet die These, „dass es im digitalen Raum weniger Möglichkeiten gibt, Differenzen zu bemerken, und sich damit auch weniger Zuschreibungen und Diskriminierungen ergeben“. Oder in Kürze: Gender könnte im digitalen Raum weitgehend verschwinden. Weil auch Körper im digitalen Raum kaum eine Rolle spielt.
Ein innovatives Untersuchungsdesign
Womit wir nun endlich beim Thema „Talking Heads“ angekommen wären. Die Forschergruppe benutzte ein innovatives Untersuchungsdesign: Neben Interviews konnten die Befragten auch Zeichnungen anfertigen. Zudem wurden Tagebucheintragungen ausgewertet. Die Stichprobe war zwar überschaubar, aber überlegt zusammengestellt: 20 weibliche als auch männliche Führungskräfte wurden befragt. Außerdem wurden 20 weibliche Young Professionals interviewt, die Führungsambitionen hegten und unter 35 Jahren waren.
Hierzu kann ich mir einige kurzen Anmerkungen nicht verkneifen: Es stellt keine neue Erkenntnis dar, dass bildlich-szenische Methoden rationale Zensurmaßnahmen unterlaufen können. Der bildhafte Ausdruck bildet zudem die Brücke zwischen Unbewussten und Bewussten – eine Erkenntnis, die beispielsweise im Zentrum des Zürcher Ressourcenmodells (Ganzheitliches Selbstmanagement) steht.
Insofern haben wir es mit solchen Methoden nicht mit „Kinderkram“ zu tun, wie manche, von quantitativer Statistik besessenen Wissenschaftler gerne kolportieren, aber selbst nur Korrelationen auf der Basis von Querschnittsuntersuchungen produzieren. Ähnliches gilt für die Methode der Tagebuchaufzeichnungen, die eine Zeitreihenanalyse eröffnet. Ich freue mich also, dass ich solche Methodenwahl in wissenschaftliche Untersuchungen inzwischen vermehrt wahrnehme. Und der Vorteil dessen lautet insbesondere: Validität.
Erhellende Ergebnisse
Die Ergebnisse der Studie lesen sich daher dicht und tiefgründig:
- Ausnahmslos alle Teilnehmenden berichten, einen Verlust von Verbundenheit zu erleben. Man erlebt sich isoliert, Kachel an Kachel im digitalen Raum.
- Es werden weniger Differenzen wahrgenommen. Das heißt, es werden auch weniger Bemerkungen über Äußerlichkeiten gemacht. Weil eben der Körper (Größe, Körperform oder Kleidung) weniger sichtbar ist. Mehr noch: Frauen erleben den digitalen Raum im Vergleich zur Präsenzbedingung teilweise als „save space“.
- Im Gegenzug gewinnen „das gesprochene Wort, die referierte Position und die Inhalte an Relevanz“.
- Es gibt es kaum eine Bühne für übliches männliches Dominanzverhalten. Weil der Raum dafür fehlt. Positionen im Raum einnehmen, sich in den Vordergrund drängen, sich ans Kopfende des Tisches setzen, solche (männliche) Selbstinszenierungsstrategien sind online nicht möglich – da klebt Kachel an Kachel.
Diese Befunde eröffnen neue partizipative Möglichkeiten. Wenn Führungskräfte die Gelegenheit ergreifen, aktiv zu moderieren (Agenda, Kommunikationsregeln etc.), wird das in virtuellen Meetings mehrheitlich als positiv wahrgenommen. Kleiner Treppenwitz der Geschichte: Das virtuelle Setting kann das Meeting demokratisieren! Wofür vor über 40 Jahren schon einmal die Moderationsmethode erfunden wurde. Tja …
Risiken und Nebenwirkungen
Natürlich werden auch Gefahren wahrgenommen: Wenn nämlich die Führungskraft genau das nicht macht. Also nicht aufmerksam und präsent ist. Oder sich sogar durch Anrufe oder E-Mails ablenken lässt. Dann entgleitet ihr die Steuerung des Meetings. Hinzukommt, dass „geschlechtsstereotypes Verhalten und damit verbundene Diskriminierung“ von (männlichen) Teilnehmenden auch im Onlinesetting nicht völlig unmöglich sind. Es äußert sich bloß anders/indirekter:
- Wiederholung von zuvor Gesagtem
- Selbstzuschreibung von durch andere geäußerte Ideen
- Unterbrechen oder das demonstrative Beschäftigen mit Anderweitigem wie „Telefonieren, Lesen, Mails beantworten – während jemand (eine Frau) spricht“
Die Herren wieder unter sich
Und es kommt noch etwas Wichtiges hinzu: Wenn die Entscheidungsfindung nicht im Online-Meeting, sondern anschließend in den physischen Raum verlagert wird. Dann spielen die „Herren“ wieder ihre Karten aus: Selbstinszenierungsstrategien wirken, der Raum wird zur Positionierung genutzt und so weiter. Und es kommt noch schlimmer: „Männer sind nach der Corona-Pandemie vermehrt in die Büros zurückgekehrt, während Frauen oft aufgrund von familiären Fürsorgepflichten oder dem nicht reflektierten Zurückfallen in bisherige Praktiken weiterhin remote arbeiten.“
Wer nicht präsent ist, also nicht im physischen (!) Raum ist, wird übergangen und von wichtigen Entscheidungen, zu denen eben auch die Karrierechancen gehören, ausgeschlossen. „Präsenz schafft Sichtbarkeit, Sichtbarkeit schafft Nähe und Nähe schafft Verbundenheit, eine nicht unwichtige Ausgangssituation etwa für Beförderungen.“
Dieser Befund wirft somit noch einmal einen etwas anderen Blick auf den Trend „back to office“ (Achtung: Hier spricht das Direktionsrecht!): Der Wind hat sich am Arbeitsmarkt allerdings wieder gedreht. Personalabbau ist wieder Thema. Schade, dass das Autorenteam um Jürgen Weibler den Blick nicht auch hierhin lenkt.
Immerhin eröffnen sie eine gleichfalls wichtige Perspektive mit einer Videoserie zu Barrieren in Frauenkarrieren: „Viele sichtbare und unsichtbare Barrieren führen Frauenkarrieren in eine Art Labyrinth, bevor sie überhaupt an der ‚gläsernen Decke‘ hängen bleiben können.“




