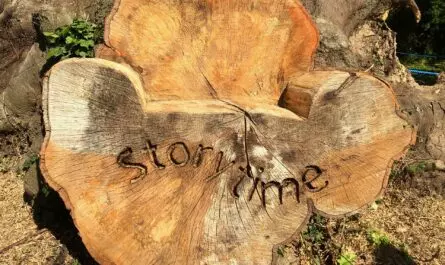INSPIRATION: Professionelle Emotionsregulation ist für Dienstleistungsarbeit essenziell. Die Kompetenz ist den Mitarbeitenden aber nicht in die Wiege gelegt. Die Personalentwicklung muss das forciert mit Trainings angehen.
Ob in der Alten- oder Krankenpflege, bei der Polizei, im Call-Center oder im Coaching – also allgemein in der Dienstleistungsarbeit – ist der professionelle Umgang mit Gefühlen entscheidend. Das aber wird von den Unternehmen nicht immer ausreichend so wahrgenommen. Geschweige denn, dass es eine wichtige Rolle in der Personalentwicklung spielen würde.
Anzeige:

Das ist mehr als bedauerlich. Denn die Folgen wären nicht nur geringeres Stresserleben, weniger körperliche Beschwerden, bessere Beziehungen zu Klienten/Kunden und Kolleg:innen sowie größere Lebenszufriedenheit der Mitarbeitenden. Sondern auch geringere Kosten durch Fehlzeiten und bessere Produktivität, so das Autorenduo (Arbeiten mit Gefühl).
Emotionsregulation
Man müsste sich wohl mal schlau machen in Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement. Denn das in der Forschung etablierte Prozessmodell der Emotionsregulation von James Gross ist nun auch schon mehr als 25 Jahre alt. Es unterscheidet zwei Hauptformen der Emotionsregulation, die präventive und die „reaktive“ Regulation. Zudem werden fünf Strategien beschrieben: Situationsauswahl, Situationsmodifikation, Aufmerksamkeitslenkung, kognitive Neubewertung und Reaktionsmodulation. – Damit lassen sich dann schnell Trainingssessions konstruieren, wie die Autoren an einem Beispiel (nebst Verweis auf weiterführende Literatur) zeigen.
Als problematisch erachte ich, dass zu den reaktiven Strategien von den Autoren allein die Emotionsunterdrückung fokussiert wird. Es ist zwar dramaturgisch verständlich – denn gleich geht’s für die Autorinnen mit dem wichtigen Thema Emotionsarbeit weiter – es zeigt aber auch, dass man sich mit den neuesten (Emotionen: Gefühlsduselei vermeiden) und wichtigen (Die emotionalen Grundlagen des Denkens) Erkenntnissen der Emotionspsychologie in der Breite vermutlich noch nicht beschäftigt hat.
Emotionsarbeit
Im Arbeitskontext seine Gefühle gut regulieren zu können, darf man meines Erachtens als Selbst-Kompetenz bezeichnen. Die fällt nicht vom Himmel, sondern ist ein Produkt der Erfahrung, der Sozialisation. Der Mitarbeitende hat da seine persönliche Lerngeschichte, und trifft auf eine spezifische Unternehmenskultur. Letztere schreibt bestimmte Regeln vor, an die sich der Mitarbeitende halten soll, so hat es in den 1980er-Jahren schon die Soziologin Arlie Hochschild beschrieben.
Beispielsweise: Der Kunde ist König! Leider verhalten sich manche Kunden nicht höflich, wie Könige, sondern grob daneben. Dann hat die Mitarbeiterin ein Problem oder Dilemma, das zumeist einseitig aufgelöst wird: Man lächelt trotzdem (Oberflächenhandeln oder „surface acting“). Und gerät damit in eine emotionale Dissonanz. Die Wahrscheinlichkeit, auf längere Sicht damit im Burnout zu landen, ist signifikant positiv, weiß die Wissenschaft.
Tiefenhandeln („deep acting“) vermeidet diesen „Highway to Hell“. Die Mitarbeitende nutzt beispielsweise die Strategien Aufmerksamkeitslenkung, kognitive Neubewertung und Reaktionsmodulation, um diese emotionale Dissonanz nicht entstehen zu lassen: Man lacht sich beispielsweise innerlich „kaputt“ über das „königliche“ Danebenbenehmen, erlebt Mitleid mit der präsentierten Dummheit – und lächelt dann völlig entspannt.
Detached Concern
Nun gibt es aber auch Arbeitskontexte, in denen der Kunde Patient ist. Also weniger „König:in“ als eher „armer Tropf“. Auch dort müssen Mitarbeitende ihre Emotionen gut regulieren können. Diese Anforderung an Emotionsarbeit wird schon länger Detached Concern genannt: Es gilt, eine gute Balance zwischen Nähe (Empathie) und Distanz (Selbstschutz) aufbauen können; was an das (Riemann-Thomann-Modell) erinnern mag.
Empathische Anteilnahme versus Abgrenzungsfähigkeit könnte man nun als Dilemma erleben. Das Autorenduo baut das in ein „Tetralemma“ um, in dem die beiden Anforderungen jeweils in hoher und niedriger Ausprägung gekreuzt werden, so dass eine Vierfeldertafel entsteht mit den Bezeichnungen: empathisch (hoch/niedrig), ausgewogen (hoch/hoch), unbeteiligt (niedrig/niedrig), distanziert (niedrig/hoch). – Na, das ist doch mal ein Fortschritt in der Modellbildung.
Kontextsteuerung
Hier kommt noch ein weiterer Aspekt ins Spiel: Mitarbeitende brauchen nicht nur besagte Kompetenz. Sie brauchen auch gute Arbeitsbedingungen als Rahmen. Und hier kommt – endlich und zwar massiv – der Arbeitgeber ins Spiel, der dafür verantwortlich ist, diese herzustellen. Gerade was den medizinischen Bereich betrifft, höre ich seit Jahren eigentlich immer nur die alte Leier, dass es genau daran fehlt.
Man kann eben auch hoch kompetente Mitarbeitende in den Burnout schubsen. Oder man nimmt endlich die seit Jahrzehnten vorliegenden Ratschläge ernst. Gut gefallen hat mir beispielsweise dieser Ansatz an der Architektur: Hausgemachte Probleme. Da bekommen die Mitarbeitenden nicht nur einen Raum, sondern auch Zeit für die Emotionsarbeit. Oder ergänzend dazu: Wir bauen das Haus rund.
Damit aber keine Missverständnisse aufkommen: Gleiches gilt für alle Dienstleistungsbereiche, nicht nur fürs Krankenhaus. Erinnert sich noch jemand an die Studien des Forscher*innenteams rund um den Berliner Coaching- und New-Work-Forscher, Carsten Schermuly, zu Risiken und Nebenwirkungen des Coachings für Coaches (Ein Branchen-Tabu)? In den Worten unseres Autorenduos (Arbeiten mit Gefühl): „Für die interaktive Arbeit mit Menschen bedarf es spezifischer Ausbildung und Schulung im Umgang mit Emotionen, was jenseits der Personalauswahl (auf die hier nicht näher eingegangen wird) in Form der Personalentwicklung eine wichtige Aufgabe des Personalmanagements ist.“ Also, Personalerinnen und BGMler, Hand aufs Herz: Das Thema Dienstleistungspsychologie ist nicht neu (Sind sie zu stark, bist du zu schwach!). Packt es an!