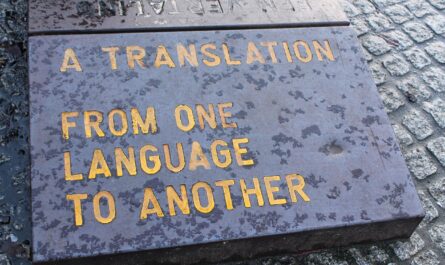KRITIK: Endlich einmal Forschung zu einem populären und praktischen Thema! Zu Schulz von Thuns Kommunikationsquadrat. Wie viele Jahre mussten wir darauf warten? Und was lernen wir nun Neues und Interessantes?
Das Kommunikationsquadrat ist ein Klassiker in der (betrieblichen) Aus- und Weiterbildung. Man erinnere sich: Jede Nachricht hat vier Aspekte: Sach-, Beziehungs-, Appell- und Selbstoffenbarungsebene (Vier Seiten einer Nachricht als Brettspiel). Und weil das nach Schulz von Thun so ist, kann eine Botschaft auch von vier verschiedenen Ohren gehört werden. Womit das Drama der Kommunikation beginnt, wenn verschiedene Schnäbel und Ohren aufeinandertreffen: „Es ist grün,“ sagt er (Beifahrer) zu ihr (Fahrerin) an der Ampel … Kommunikative Missverständnisse, Streit – all das lässt sich so wunderbar erklären.
Anzeige:
 Ihre Motive treiben Sie an - Ihre Werte bieten Ihnen Orientierung - Ihre Begabungen ermöglichen Ihnen Ihre Ausführungsfreude. Die Analyse Ihrer drei eigenen Emotionsbereiche zeigen Ihnen Ihr Potenzial für förderliches oder hinderliches Verhalten in verschiedenen Kontexten auf. Warum? Ihre Entscheidungen basieren auf Ihre Emotionen. Sie analysieren und bewerten sich selbst - kein anderer. Sie sind für Ihr psychologischen Wohlbefinden selbst verantwortlich, in deutsch oder englisch. Zur Website...
Ihre Motive treiben Sie an - Ihre Werte bieten Ihnen Orientierung - Ihre Begabungen ermöglichen Ihnen Ihre Ausführungsfreude. Die Analyse Ihrer drei eigenen Emotionsbereiche zeigen Ihnen Ihr Potenzial für förderliches oder hinderliches Verhalten in verschiedenen Kontexten auf. Warum? Ihre Entscheidungen basieren auf Ihre Emotionen. Sie analysieren und bewerten sich selbst - kein anderer. Sie sind für Ihr psychologischen Wohlbefinden selbst verantwortlich, in deutsch oder englisch. Zur Website...
Kennen wir, haben wir schon tausend Mal gehört, trainiert … Bestseller eben. Weniger bekannt ist, dass Schulz von Thun bei Watzlawick & Co. „geklaut“ hat. Und dass Forscher wie Jürgen Kriz (Ganzheitliche Psychologie) oder Wolfgang Tschacher (Embodiment: Ganz von dieser Welt) das Kommunikationsgeschehen dann noch mal deutlich differenzierter unter die Lupe genommen haben. Aber wir wissen natürlich auch: Das „Volk“ liebt eher die quadratisch-praktischen Lösungen als die differenzierten.
Das Kommunikationsquadrat
Aber eine Frage war all die Jahre offen geblieben: Ist das Kommunikationsquadrat bloß Beraterlatein? Oder kann man empirisch die den Empfang einer Nachricht beeinflussenden Faktoren nachweisen, quantifizieren und qualifizieren? Hier setzt die Studie der Autorengruppe (Kommunikationsquadrat: Eine empirische Analyse …) an. Ihnen haben es insbesondere die nonverbalen Nachrichtenanteile angetan: „Gesichtsausdrücke“ (…) „übermitteln insbesondere den emotionalen Zustand einer Person.“ Auweia! Wer meine Posts der vergangenen Monate verfolgt hat, wird nachvollziehen können, dass sich mir unmittelbar die Nackenhaare sträuben. Doch gemach! Lassen wir die Herrschaften zunächst ihre Überlegungen und Forschung darstellen. Dann kommt die Kritik.
„Kommunizieren Menschen miteinander, schwingen laut diesem Modell stets Botschaften auf einer Sachseite, einer Beziehungsseite, einer Selbstkundgabeseite sowie einer Appellseite mit.“ Quatsch! Mein guter Vorsatz ist schon perdu! Auf irgendwelchen Ebenen schwingt gar nichts. Botschaften schon gar nicht, weil es die „an und für sich“ gar nicht gibt. OK, ich beiße mir trotzdem erstmal auf die Zunge!
Kontext, Tonfall, Formulierung sowie Mimik und Gestik sind die Aspekte, die auf die Interpretation einer Nachricht Einfluss nehmen, so Schulz von Thun. Und es ist klar: Die Widersprüche, die hier wahrgenommen werden können, sind das Salz in der Suppe: „Es ist grün …“. „Eine umfangreiche Literaturrecherche Anfang 2024 konnte keine dahingehende empirische Studie identifizieren, wie sich die verschiedenen Ausprägungen des Tonfalls, des Kontexts, der Art der Formulierung sowie der Mimik und Gestik auf den Empfang einer Nachricht auswirken,“ so die Autoren.
Basisemotionen
Was liegt also näher, als sich hier einen vielversprechenden Aspekt herauszupicken: die Mimik. Dazu hat der emotionspsychologische Altmeister Paul Ekman doch schon vor Jahrzehnten Vielbeachtetes veröffentlicht (Ausdruckspsychologie). Die Forscher konzentrieren sich auf die Gesichtsausdrücke Trauer, Wut und Angst. Ihr Ansatz: Eine quantitative Online-Fragebogenstudie zum Einfluss der Gesichtsausdrücke Trauer, Angst und Wut „auf den Empfang einer Nachricht auf der Sach-, Beziehungs-, Selbstkundgabe- und Appellseite des Kommunikationsquadrats“.
Wie das so üblich ist, leiten die Forscher zunächst ihre Hypothesen her. Dazu wird beispielsweise (mit Schulz von Thun) behauptet, die Sachseite der Kommunikation sei emotionslos. Sie sei auch bei rein nicht-sprachlichen Nachrichten im Regelfall leer. Negative Gefühlsäußerungen würden häufig als Zuweisung der Täterschaft interpretiert und damit der Beziehungsseite zugeordnet. Oder allgemeiner: „Die Information, wie die sendende zur empfangenden Partei steht, wird hauptsächlich über qualifizierende Begleitbotschaften, beispielsweise Mimik, vermittelt und weniger über das explizit Gesagte.“ Negative Emotionen, so behaupten die Forscher (mit Schulz von Thun) seien zudem oft eine Kernbotschaft der Selbstkundgabe. Sie würden auch gerne an einen Appell gekoppelt.
Die Studie
Die Stichprobengröße lag mit N=266 über dem zuvor errechneten Minimum der Poweranalyse, so dass man statistisch signifikante Ergebnisse erhoffen konnte. Den Teilnehmenden wurden, nachdem man ihnen zuvor das Kommunikationsquadrat erklärt hatte, zufällig drei Szenarien präsentiert. „Pro Szenario wurde jeweils die identische Nachricht mit Bildern mimischer Ausdrücke der Basisemotionen Trauer, Angst und Wut kombiniert.“ Aufgabe der Teilnehmenden war zu beantworten, zu welchem Ausmaß „sie die Nachricht jeweils auf den vier Seiten des Kommunikationsquadrates empfangen“. Die Ergebnisse bestätigten die erwarteten Vorannahmen: Die Teilnehmenden haben Nachrichten signifikant stärker auf der
- Sachseite empfangen, wenn diese mit neutraler Mimik statt mit den Gesichtsausdrücken Trauer, Wut oder Angst dargeboten wurden.
- Beziehungsseite empfangen, wenn diese mit den Gesichtsausdrücken Trauer, Wut oder Angst statt mit neutraler Mimik dargeboten wurden; Wut war hier besonders wirksam.
- Selbstkundgabeseite empfangen, wenn sie mit den Gesichtsausdrücken Trauer, Wut oder Angst statt mit neutraler Mimik dargeboten wurden; Wut war hier besonders wirksam.
- Appellseite empfangen, wenn sie mit den Gesichtsausdrücken Trauer, Wut oder Angst statt mit neutraler Mimik dargeboten wurden; Wut war hier besonders wirksam.
Da waren die Forschenden glücklich und berichten zudem von weiteren Alters- und Bildungseffekten, die man noch genauer untersuchen müsste.
Die Kritik
Meine Leserschaft kann es vermutlich kaum erwarten, dass ich nun darlege, was ich an der Studie auszusetzen habe. Es sind gravierende Dinge.
- Zunächst haben die Teilnehmenden brav die Ostereier gefunden, die die Forscher für sie zuvor versteckt hatten. Die ganze Studie ist also nichts als ein Zirkelschluss (Artefakt). Was die Autoren unter Limitationen auch beschwichtigend, aber eher kleinlaut einräumen. – Übrigens haben sie damit denselben Fehler gemacht, den die Forschung auch Ekman vorwirft (s.u.).
- Was diese Studie überhaupt nicht leistet ist, das Modell Kommunikationsquadrat empirisch zu validieren. So könnte man die vier Seiten der Kommunikation leicht auf zwei reduzieren: Appell und Selbstoffenbarung sind doch gleichfalls Beziehungsaspekte. Damit könnte man die Ergebnisse dieser Studie und deren Homologie eben auch interpretieren.
- Sprich: Da müsste man sich doch tiefer und qualifizierter ins Thema Kommunikationstheorie reingraben und von Vorstellungen wie „A sagt was und der B hat dann etwas verstanden“ Abstand nehmen – wie das schon die „Lorenztreppe“ nahelegt: „Gesagt ist nicht gehört, gehört ist nicht verstanden …“. Jürgen Kriz spricht von Synlogisation (Ganzheitliche Psychologie). Unter der Latte sollte man nicht durchlaufen.
- Dann muss das verwandte emotionspsychologische Konzept der Basisemotionen nach Ekman als unpassend – und widerlegt (!) bezeichnet werden. Sowohl Feldman Barret (Emotionen: Gefühlsduselei vermeiden) als auch Patterson und Kollegen (4 Irrtümer über nonverbale Kommunikation) belegen das ausführlich. Gleichfalls wäre auf die Arbeiten von Ciompi (Die emotionalen Grundlagen des Denkens) und Tschacher (Embodiment: Ganz von dieser Welt) verwiesen.
Das „Volk“ liebt eher die quadratisch-praktischen Lösungen als die differenzierten, habe ich eingangs gesagt. Es spricht aber andererseits nichts dagegen, Menschen zu ermutigen, differenzierter zu denken, zu fühlen und zu handeln. Lisa Feldman Barrett nennt das: Emotionale Granularität. Nach dem alten Heinz Erhardt-Motto: „Sie dürfen nicht alles glauben, was Sie denken!“.
Und eine Anekdote
Da fällt mir zum Schluss noch eine Anekdote ein: Beim Gang über Europas größte Personalermesse kam ich schließlich am Stand der Firma einer personaldiagnostischen Koryphäe an und konfrontierte den Professor mit meiner Empörung über etliche, aufgeplusterte Ausstellerstände, an denen Persönlichkeitstests nach dem altbekannten, unwissenschaftlichen Vier-Farben-Schema präsentiert wurden. Da lachte der Professor lauthals und erwiderte: „Aber Webers, Sie müssen das doch mal so sehen: Früher sagten die Leute, mein Chef ist ein A… Heute sagen sie: Mein Chef ist ein Roter und ich ein Grüner. Und deshalb verstehen wir uns nicht so gut. – Das ist doch ein Fortschritt!“ – Wollen Sie auch meine Antwort hören? „Und wie groß ist dieser Fortschritt, Herr Professor?“