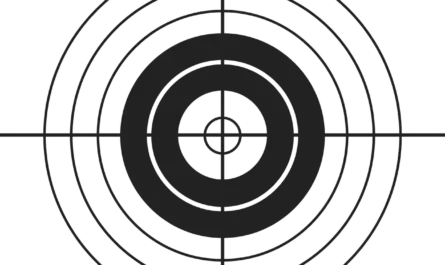KRITIK: Worum geht es wohl, wenn Sie diesen Satz lesen: „Dafür ist es erforderlich, dass sie abstrahieren, Probleme lösen, sich selbst steuern und organisieren können.“ (Dahm/Walther: Mensch und Maschine wachsen zusammen S.56). Genau: Es geht um die Kompetenzen von Mitarbeitern im Zeitalter des Internets der Dinge. Auch wenn das für mich Kompetenzen sind, die schon länger gefragt sind – was hat es auf sich mit dem „Internet der Dinge“?
Letzteres ist schnell erklärt: Produkte bekommen eine neue Eigenschaft: Sie können Daten empfangen und senden. Welche Produkte? Kühlschränke (das Dauer-Beispiel), Autos, Herzschrittmacher, elektrische Zahnbürsten… Wieso Zahnbürsten? Naja, sie registrieren, wie und wie oft Sie Ihre Zähne bearbeiten, senden die Daten an Ihr Smartphone, das Ihnen dann erklärt, was sie besser machen können. Vielleicht erhält auch noch Ihr Zahnarzt die Daten, dann kann er per Fernsteuerung Ihre Zahnbürste neu einstellen.
Anzeige:
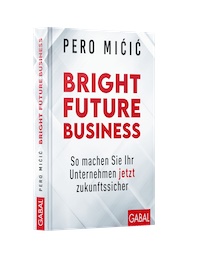
Aber wieso der Zahnarzt? Das wird ein Algorithmus übernehmen. Sorry, ein kleine Umweg. Zum eigentlichen Thema: Wenn über Unternehmen und Grenzen hinweg Produkte miteinander „reden“, sich selbst bestellen und abbestellen – was macht dann noch der Mensch? Er steuert und überwacht die Abläufe – im Extremfall starrt er nur auf seine elektronisches Endgerät (auch gerne zu Hause oder am Strand) und lässt sich informieren, wenn etwas außer Ruder läuft.
Aber was macht er dann? Muss er sich mit der Technik auskennen? Wohl kaum, er wird ja kaum vor Ort sein. Zudem wird sich kaum jemand mit der hochkomplexen Materie noch wirklich auskennen. Er wird also im besten Fall gar nichts zu tun haben, wenn die Technik funktioniert, ist er praktisch überflüssig. Aber wenn es knirscht, muss er wissen, wen er ansprechen muss. Es kommt also auf die Kommunikation an, und das in virtuellen Umgebungen, wo der Ansprechpartner irgendwo auf der Welt mobil arbeitet.
Ist das alles wirklich neu? Ich kann mich an Diskussionen mit Messwartenfahrern in Industrieanlagen erinnern, die hoch qualifiziert waren und nächtelang vor Bildschirmen saßen, auf denen die Messwerte abgebildet wurden. In der der Regel hatten sie reine Kontrollaufgaben – eingreifen mussten sie höchst selten. Also waren sie einerseits unterfordert, weil ihre Fähigkeiten und Kenntnisse nur im Notfall gefragt wurden. Andererseits wurde die Technik immer komplexer, so dass immer weniger eigentlich wussten, was sich in all den Apparaten und Maschinen abspielte.
Nichts anderes scheint mir jetzt zu passieren, nur dass immer mehr automatisiert wird und ohne einen einzigen Eingriff durch Menschen abläuft. Aber wehe, es geht etwas schief – wer kennt sich dann aus mit all den Steuerungssystemen und Programmen, die die komplette Lieferkette vom Rohstoff bis zum Kunden beherrschen?
Mobiles Arbeiten
Ach ja, noch etwas zum „mobilen Arbeiten“. Wenn die Daten der vernetzten Maschinen und Produkte auf jedem Smartphone abgerufen werden können, dann könnten die (wenigen) Mitarbeiter, die noch den Durchblick haben, diese ja auch von jedem Ort der Welt einsehen. Wenn sie nicht vor Ort eingreifen, sondern nur ein wenig im Code herumdoktern müssen, ist ihre Anwesenheit nicht mehr gefragt.
Dieses „mobile Arbeiten“ zieht überall ein, erklären uns Autoren eines anderen Beitrags (Prümper/Becker/Hornung: Ein Zug rollt los. S.61). Unter anderem führen sie als Beispiel die Gastronomie an, wo Bestellungen und Kundenberatung von mobilen Endgeräten unterstützt werden. Ich frage mich, was da unter mobilem Arbeiten verstanden wird? Sitzt die Servicekraft dann selbst irgendwo auf der Welt im Café und steuert den Servicecomputer, der anschließend den Tisch abräumt? Oder die Drohne, die das Bestellte zum Gast fliegt?
Auch wenn hier behauptet wird, „mobiles Arbeiten erobert die Mehrheit der Beschäftigten“, halte ich das für Unsinn. Schreibt jemand, der tatsächlich meist „unterwegs“ arbeitet, aber sein Büro noch sehr zu schätzen weiß.