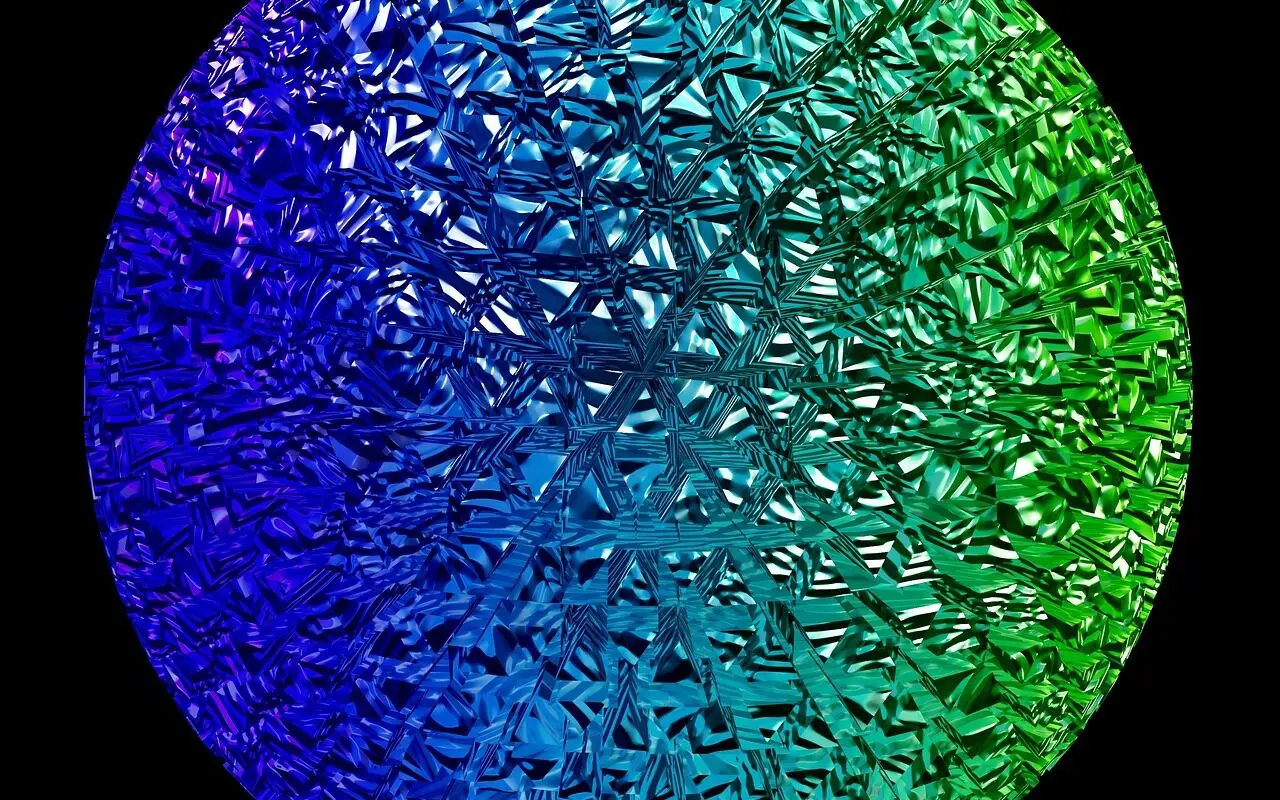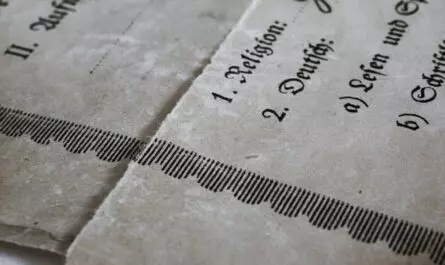Kritik: Ich hatte das Heft schon zu Seite gelegt, nachdem ich das Interview mit der Personalchefin von SAP gelesen hatte. Aber deren Aussagen haben mich dann doch zu sehr beschäftigt. Sie erinnern sich? SAP holte seine Mitarbeitenden nach der Corona-Zeit ins Büro zurück, führte nicht nur Leistungsbeurteilungen wieder ein, sondern sogar ein ziemlich schlichtes Modell, das sich offenbar an der Erreichung von Zielen orientiert. Und schließlich sorgte man für Aufsehen, weil sich das Unternehmen den neuen Vorgaben in den USA beugte und Diversity-Regelungen über Bord warf.
Genug Material, um einiges zurecht zu rücken, dachte ich, und war gespannt auf die Aussagen der obersten Personalerin (Es geht nicht um Triezen und Piesacken). Und dann doch arg enttäuscht. Fangen wir mal hinten an. Nein, sagt sie, in Sachen Diversity habe man nichts eingestellt. Aber weil der US-Präsident per Dekret entschieden habe, das niemand wegen Herkunft oder Geschlecht bevorzugt werden darf, und bei SAP offenbar Vorstandsvergütungen unter anderem an bestimmte Quoten gekoppelt waren, strich man eine Kennzahl aus diesem Katalog. Die Diversity-Ziele habe man aber nicht geändert, behauptet sie. Nur gibt es dafür eben keine Kennzahl mehr. Aha.
Anzeige:
Veränderungen gemeinsam bewusst zu gestalten und das komplexe Zusammenwirken aller Beteiligten wirksam zu verzahnen, damit sie ein Unternehmen voranbringen - dabei begleitet Gabriele Braemer mit clear entrance® seit über 20 Jahren Organisationen rund um den Globus. Mit strategischem Know how, methodischer Vielfalt und einem echten Interesse für Ihr Anliegen. Zur Webseite...

Die Begründung? Man habe ein umfangreiches Geschäft mit dem öffentlichen Sektor in den USA. Es geht also ums Geschäft. Und natürlich um Arbeitsplätze, schließlich wolle man nicht die der 18.000 Mitarbeitenden in den USA gefährden. Dass andere Unternehmen sich von solchen Dekreten nicht beeindrucken ließen, ficht sie nicht an, über die Rechtslage gebe es unterschiedliche Auffassungen. Mit anderen Worten: Man wollte eben nicht riskieren, große Kunden zu verlieren. Das ist immerhin ehrlich.
In Sachen Homeoffice lautet das Argument: Man stelle jedes Jahr 10.000 neue Mitarbeiter ein, die sollen nicht in ein leeres Büro kommen. Inzwischen sei die Präsenz wieder so wie vor der Pandemie. Die Kritik habe nachgelassen, und schließlich gibt es auch Ausnahmeregelungen. Klingt nicht wirklich so, als habe man dazugelernt.
Uraltes Performance-Management-Modell
Aber besonders interessant ist, was die Wirtschaftspsychologin über das neue Performance-Management-System sagt. Dort werden die Beschäftigten in drei Zonen eingeteilt: Blau für die Top-Leister, Grün für diejenigen, die die Erwartungen erfüllen, und Gelb für alle, die Verbesserungspotenzial haben. Das ist so bitter rückwärtsgewandt wie nur irgendwas, alles schon vor Jahrzehnten eingesetzt und nicht wirklich bewährt. Die Interviewer haken nach. Was muss jemand tun, wenn er von grün nach blau will? Antwort: Muss man doch gar nicht, das System ist fluide, mal sei man eben in grün, mal in blau. Das sei doch nicht schlimm. Wer immer in blau sei, der hatte vielleicht zu einfache Ziele.
Wenn die Realität denn so wäre. Ich möchte wetten, dass Beförderungen und vermutlich auch Prämien von der Erreichung von Zielen abhängen. Dann möchte ich die Führungskraft sehen, die einem Mitarbeitenden erklärt: „Sei nicht traurig, dass ich dich diesmal in grün eingestuft habe, auch wenn deine Prämie jetzt etwas geringer ausfällt und auch wenn das jetzt für immer in deiner Personalakte steht. Es kommen auch andere Zeiten. Wie, du willst in blau? Tut mir leid, da kann ich dir nicht helfen. Das geht nur, wenn ich die Ziele herabschraube, aber das darf ich nicht, denn das Unternehmen ist ehrgeizig. Also gib Ruhe.“
Und dann erfährt der Mitarbeitende, dass Kollege X ein blauer ist, und wenn er sich traut nachzufragen, warum, dann zitiert sein Chef die Personalleiterin: „Nur Top-Performer – das ist nicht realistisch für ein Unternehmen. Dann läuft etwas schief.“ Was durch die Blume bedeutet: Ich kann nicht alle in blau einordnen, dann kriege ich Ärger.
Zukunftsmusik
Und wie funktioniert das Modell? Die Frage kommt zu früh, erst in diesem Jahr erfolgt eine erste Einschätzung. Dann, so meine Prognose, wird das System den Weg all solcher Modelle gehen: Man wird daran herumbasteln, Kriterien ändern, neben dem Blau eine Hellblau und noch ein Hellgrün oder ähnliches hinzufügen, enorm viel Zeit und Aufwand verschwenden und am Ende alles wieder über den Haufen werfen.
Eine letzte Anmerkung: Natürlich gibt es auch ein Skillmanagement. Schließlich hat SAP ja selbst eine HR-Software am Start. Erstaunlich: Erst Anfang nächsten Jahres ist das System für alle Mitarbeitende nutzbar. Und dann? Dann erkennt die KI, welche Fähigkeiten ihnen noch fehlen und wird ihnen Trainings und Maßnahmen empfehlen, um ihre Lücken zu schließen. Ob die Personalchefin tatsächlich all das glaubt, was sie hier erzählt? Das Interview dürfte ihr wenig Spaß gemacht haben …