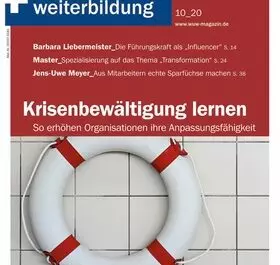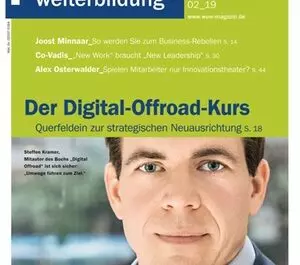INSPIRATION: Fehler passieren. Immer. Überall. Sie sind „keine Störung des Systems – sie sind ein Teil des Systems“. Vor allem sind sie eine Chance, die Zukunft zu gestalten. Indem aus ihnen gelernt wird. Kalter Kaffee? Schon tausend Mal gelesen?
Irgendwie schon, und dennoch scheinen die meisten Organisationen aus diesen Binsenweisheiten keine Konsequenzen zu ziehen. Ich nehme mal als Beispiel ein Unternehmen, in dem es darauf ankommt, mit den Daten, die die Kunden liefern, kompetent umzugehen, sie zu verarbeiten und möglichst fehlerfreie Berichte hieraus zu generieren. Dabei kommt es nahezu täglich vor, dass eine Kollegin feststellt, dass ein Kollege, der ihr zuarbeitet, Dinge übersehen hat. Falsch kategorisiert hat. Zu spät geliefert hat. Was auch immer. Fehler über Fehler. Die dann mit viel Aufwand korrigiert werden müssen. Oder bei denen man hoffen muss, dass der Kunde sie nicht bemerkt.
Unrealistisch? Von wegen. Wer jetzt glaubt, dass hier jemand eingreift und versucht, daran etwas zu ändern, der irrt sich. Weil es dann heißt: „Lieber nicht kritisieren, der Kollege könnte sonst geknickt sein, beleidigt reagieren, ausfallen oder gar kündigen.“ Also bleibt alles beim Alten. Wie geht das besser? Die Autoren in neues lernen (Fehlerkultur neu denken) empfehlen Maßnahmen auf drei Ebenen:
Reflexion und noch mehr Reflexion
- Auf der individuellen Ebene: Es den Mitarbeitenden ermöglichen, sich mit der eigenen „Fehlerbiografie“ auseinanderzusetzen, die eigenen Muster erkundschaften und sich so neue Handlungsräume erschließen. Dazu sind Lerntagebücher, kollegiale Beratung und Supervision hilfreich.
Respekt, denke ich da, so geht man die Sache grundlegend an. Wer in unserer Organisation arbeitet, der darf sich mit seiner „Fehlerbiografie“ beschäftigen. Und vielleicht noch mit seiner „Konfliktbiografie“. Und seiner „Innovationsbiografie“. Und seiner „Kooperationsbiografie“. Und so weiter. Realistisch?
Keine Frage, manchen Kollegen würde man gerne eine solche Selbsterkundung ans Herz legen. Wobei die Frage lautet, wie weit man als Organisation da gehen will? - Auf der Teamebene: In den meisten Teams fehlt es an der kritischen Auseinandersetzung mit Pannen und Fehlern. Dazu braucht es Zeit, z.B. für Retrospektiven. Sonst ändert sich wenig. Wohl wahr.
- Auf der Organisationsebene: Wird dort (also z.B. im Management, nach großen Projekten oder gescheiterten Initiativen) offen über das Scheitern gesprochen? Können Führungskräfte Fehler zugeben? Sind Reflexionsformate üblich und gewünscht? Gibt es klare Zuständigkeiten?
Fehlerarten
Der Beitrag enthält noch einen weiteren wichtigen Hinweis zum Umgang mit Fehlern. Nämlich eine gemeinsame Sprache bei diesem schwierigen Thema zu finden. Sehr hilfreich könnte es hierfür sein, nach Fehlerarten oder -typen zu unterscheiden. Denn ein gescheitertes Experiment z.B. ist etwas anderes als eine Unachtsamkeit.
Womit wir bei den neun Fehlerarten nach Amy Edmondson sind, die da wären: Abweichen (bewusster Verstoß gegen eine Regel, einen Prozess), Unachtsamkeit (versehentliche Abweichung von einer Vorgabe), mangelnde Fähigkeit (fehlendes Training bei einfacher Aufgabe), unzulänglicher Prozess (bei kompetenter Person), Herausforderung (Aufgabe zu komplex oder zu schwierig), komplexer Prozess, Unsicherheit (unverhersehbare Ereignisse), Hypothese testen (gescheitertes Experiment) und exploratives Testen (Experiment ohne These).
Einleuchtend, dass von Fehlerart 1 bis 9 sehr unterschiedliche Maßnahmen nötig sind: Die ersten gilt es abzustellen, die letzten sollten eher gefördert werden. Wobei auch das nicht generell gleich bedeutsam oder gar ratsam ist: Eine Unachtsamkeit beim Schreiben einer Mail kann durchaus großzügig übersehen werden, während sie sich im Hochsicherheitsbetrieb möglichst nicht wiederholen sollte. Und ein Experiment kann in einem Bereich höchst wertvoll, im anderen lebensgefährlich sein.
Soll heißen: Es sollte auch innerhalb der Fehlerarten sehr wohl differenziert werden, aber zumindest hilft schon die unterschiedliche Benennung. Damit ein gemeinsames Verständnis der Fehler und damit auch der bessere Umgang mit ihnen wahrscheinlicher wird.
Ich finde, es würde sich für das oben beschriebene Unternehmen lohnen, mal genauer auf die Fehler zu schauen und zumindest eine gemeinsame Sprachregelung zu suchen. Noch besser wäre es natürlich, sich regelmäßig über die geschehenen Fehler auszutauschen. Wobei man am besten ganz oben anfängt.