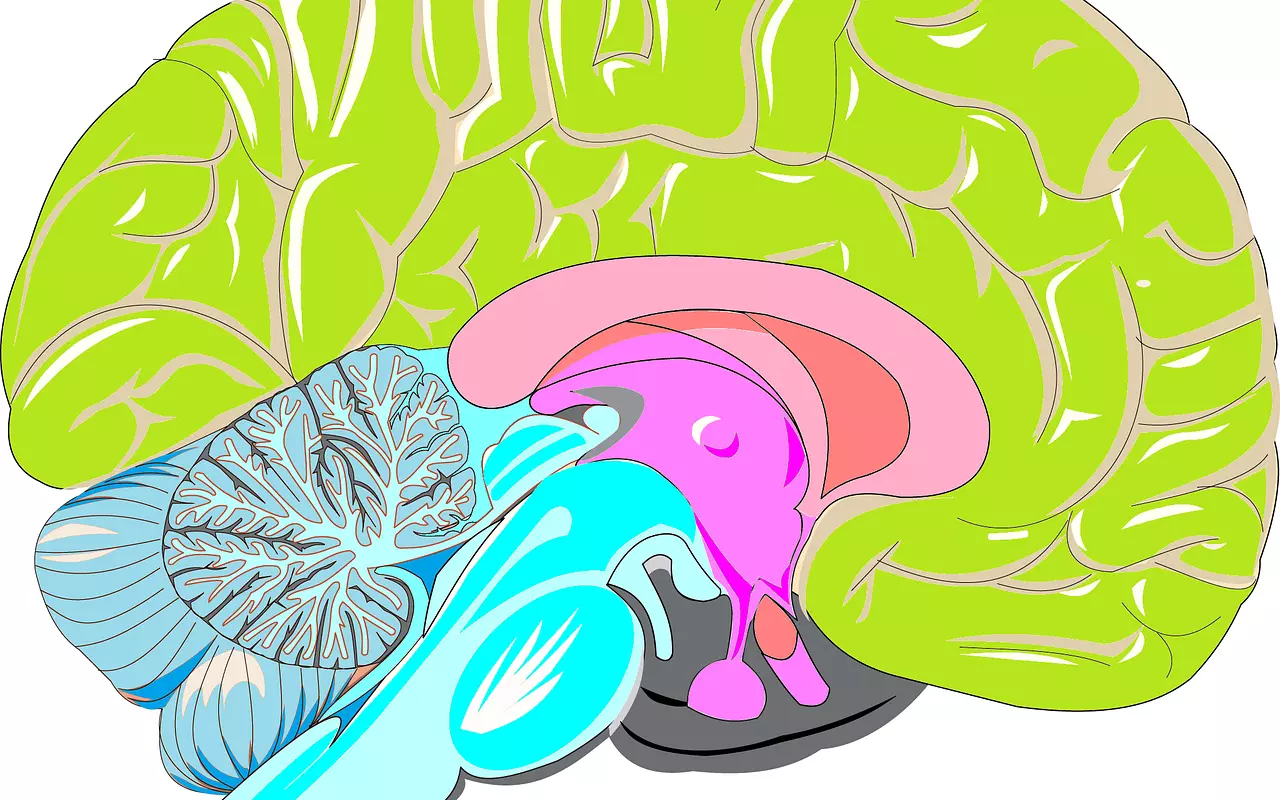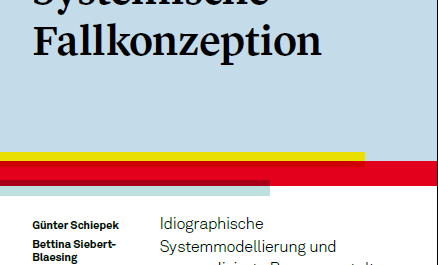INSPIRATION: Als Coach beruft man sich gerne auf die wissenschaftliche Fundierung der eigenen Ansätze, leider aber sind diese oft eher populärwissenschaftlich und alles andere als fundiert. Licht ins Dunkel können Erkenntnisse der Hirnforschung bringen, aber auch hier sind die angeblich wissenschaftlichen Erkenntnisse schlichtweg Unsinn und die Begriffe werden falsch verwendet.
In einem Beitrag der Wirtschaftspsychologie-aktuell (Unbewusste Muster überlernen) stellen Gerhard Roth und Alica Ryba das vier Ebenen-Modell der Persönlichkeit aus neurowissenschaftlicher Sicht vor und welche Konsequenzen dieses Modell für das Coaching hat. Hier die vier Ebenen:
Anzeige:
Lösungsfokussiertes Arbeiten mit Teams! In einem 2tägigen Seminar für Coaches und Berater:innen lernen Sie diesen erfolgreichen Ansatz von Ben Furman erfolgreich in die Praxis umzusetzen und schließen mit dem internationalen Zertifikat Reteaming®-Coach ab! In Deutschland nur hier: Zur Webseite...

- Die untere limbische Ebene – hier werden die biologischen Körperfunktionen gesteuert und die psychichen Antriebe, sie machen das Temperament des Menschen aus – alles natürlich unbewusst.
- Die mittlere limbische Ebene, die die frühkindlichen Erfahrungen repräsentiert, vor allem die Bindung an die ersten Bezugspersonen – auch unbewusst.
- Die obere limbische Ebene – Erlebnisse der späteren Kindheit lagern hier, sie steuern die Intuition und können auch erinnert werden.
- Die kognitiv-kommunikative Ebene – die sich ab dem 3. Lebensjahr entwickelt und auf der wir verstandesmäßig handeln.
Wie unsere Persönlichkeit von diesen vier Ebenen gestaltet wird, hängt von der Ausprägung der sechts „psychoneuralen Grundsystemen“ ab, die da lauten:
- Stressverarbeitungssystem
- Selbstberuhigungssystem
- Bindungssystem
- Impulshemmungssystem
- Motivationssystem
- Realitäts- und Risikowahrnehmungssysten
Diese bilden sich von weit vor der Geburt (Stressverarbeitungssystem) bis in der späten Kindheit aus, alle hängen mit bestimmten Neurotransmittern und Hormonen zusammen und können sich gegenseitig fördern oder hemmen.
Was hat nun der Coach davon? Bis heute gibt es laut den Autoren keine wirklich guten Theorien zur Funktion von Coaching. Weiter ist man da in der Forschung bei psychotherapeutischen Ansätzen, und nicht zu Unrecht ist wohl auch der Rückgriff auf diese beim Coaching erlaubt. Denn, so die Autoren, die Abgrenzung ist schwierig, es geht bei beiden um die Veränderung von Verhalten, und hier gibt es fünf Ansätze:
- Die Beziehung zwischen Coach und Klient – der bekannteste und am besten gesicherte Erfolgsfaktor
- Die Ressourcenaktivierung – die Fähigkeiten und Persönlichkeitseigenschaften des Klienten werden als positive Ressource genutzt.
- Die Problemaktivierung – neues Verhalten wird in realen Problemsituationen erfahren, z.B. in Rollenspielen.
- Die motivationale Klärung – der Klient wird sich der Ursprünge und Hintergründe seines problematischen Verhaltens bewusst, das Verständnis dient zur Ermutigung.
- Die Problembewältigung – das neue Verhalten wird eingeübt, die alten Muster „überlernt“.
Und was helfen uns dabei die Erkenntnisse der Hirnforscher? Letztlich lautet die Botschaft: Coach, sei dir bewusst, dass das limbische System einen sehr großen Einfluss auf die Psyche, das Erleben und Verhalten hat, und das ein problematisches Verhalten durch „Eingriffe“ auf der kognitiven Ebene, also durch Einsicht, kaum zu beeinflussen ist. Soll heißen: Ob eine Reflexion des Problems bzw. des eigenen Verhaltens Wirkung erzielt, hängt sehr von der Problemart, -urscache und -tiefe ab.
Oder noch anders ausgedrückt: Versprich deinem Klienten nicht zu viel und mache ihm klar, dass eine Problembearbeitung vor allem eins ist: Arbeit! Und wenn er das bezweifelt, nutze das Vier-Ebenen-Modell der Hirnforscher, so mancher eher wissenschaftlich orientierte Klient kann glaubt dir das dann vielleicht eher.