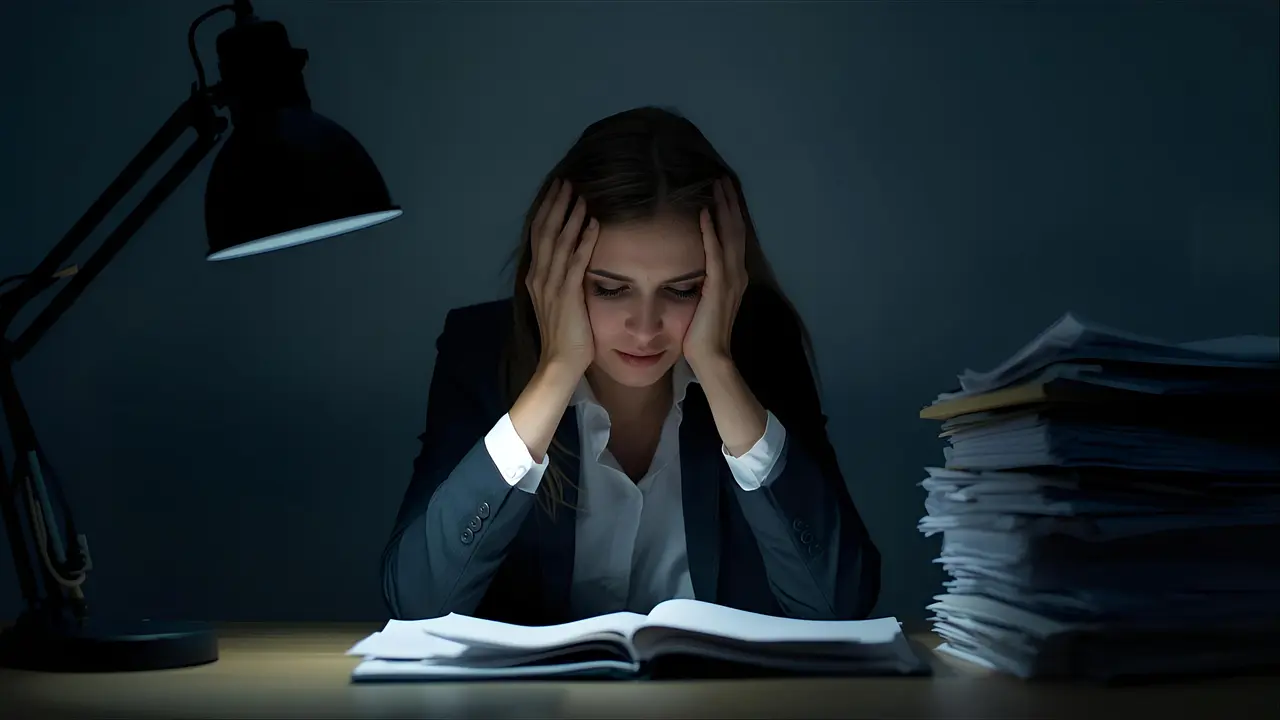INSPIRATION: Was passiert, wenn eine neue Technologie auftaucht? Und was, wenn eine unerwartete Krise die Welt trifft? Und was, wenn sich auch noch die Auffassung von Arbeit verändert? Und das alles gleichzeitig?
Vielleicht ist das eine arg verkürzte Darstellung von den Dingen, von denen inzwischen viele Unternehmen betroffen sind. Tatsächlich ist es ja noch viel schlimmer: Auch wirtschaftlich stehen viele Unternehmen unter hohem Druck. Und mit ihnen ihre Beschäftigten. Kein Wunder, dass viele unter Erschöpfung leiden.
Anzeige:
Wir sind Experten für 360° Feedback-Instrumente und für Mitarbeiterbefragungen, die wirklich etwas verändern. Unser erfahrenes Team unterstützt unsere Kunden in allen Projektphasen, also von der Konzeption über die Ein- und Durchführung bis hin zur Arbeit mit den Ergebnissen. Unsere innovativen Tools sind 'Made & hosted in Germany', werden inhouse entwickelt und ständig optimiert. Neugierig?
Zur Webseite...

Um auf den Einstieg zurückzukommen: In der Corona-Pandemie schickten die meisten Unternehmen ihre Büroangestellten nach Hause, stellten ihnen die notwendige Technik zur Verfügung und erlaubten ihnen eine ungewohnte Form der Selbstorganisation. Notgedrungen. Natürlich ermöglicht durch eine Technik, die Menschen nicht nur weltweit miteinander vernetzt, sondern sie auch noch in Echtzeit mit Live-Schaltung direkt zusammenbringt.
Siehe da, was vorher undenkbar war, funktionierte. Die Menschen wurden dafür gefeiert, man dankte ihnen für ihren Einsatz und ihre Produktivität, die unter den neuen Bedingungen nicht gelitten hat. Doch was passiert nun? Wieder stehen die Firmen unter großem Druck, die Welt wird unberechenbarer, Planungen von heute sind morgen obsolet, auf kaum noch etwas kann man sich verlassen.
Neues Misstrauen
Wie reagieren die Unternehmen? Sie beordern ihre Beschäftigten zurück ins Büro. Nachdem sie gezeigt haben, dass sie das Vertrauen verdient hatten und sie in der Lage sind, sich selbst zu organisieren. Die Botschaft? „Wir misstrauen euch doch mehr als wir euch vertrauen.“ Wie das wohl ankommt? Nicht gut, sagt Heike Bruch im Interview im Harvard Business Manager (Es ist kompliziert). Weil sie sich abgewertet fühlen. Und weil sie sich die einmal genossene Freiheit nicht wieder nehmen lassen wollen.
Offenbar hat man wenig gelernt in den Chefetagen. Nur wenige haben über das Ende der Pandemie hinausgedacht und versäumt, „ihre Unternehmenskultur gezielt weiterzuentwickeln.“ Denn so viel ist auch klar: Es geht nicht nur ums Homeoffice, sondern um eine tatsächlich neue Art der Arbeit, um Selbstorganisation und Flexibilität. Erschütternde Erkenntnisse einer Langzeitstudie: In 2016 setzten 6% der Unternehmen moderne Arbeitsformen ein und waren damit erfolgreich. 19%, die es versuchten, waren damit überfordert. Inzwischen ist der Anteil der erfolgreichen Pioniere auf 14% gestiegen, aber der Anteil der Überforderten auf satte 39%.
High-Pressure oder High-Energie?
Worin unterscheiden sich beide? Die einen setzen den Fokus ausschließlich auf Leistung, geben den äußeren Druck nach innen weiter (High-Pressure-Unternehmen) und sitzen in der Beschleunigungsfalle. Laut Bruch gehören hierzu 46% der Unternehmen, und es werden eher mehr als weniger. Das gegenteilige Muster nennt sie High-Energy-Unternehmen. Diese gehen offenbar anders mit Druck um. Hier werden gegenseitige Unterstützung gefördert, man achtet aufeinander, verfolgt die Ziele gemeinsam, in die Mitarbeitenden wird gezielt investiert.
Die Idee ist also, Hochleistung und Wohlbefinden gleichzeitig zu fördern. Das gelingt, wenn von oben klar kommuniziert wird, wie die Ziele und Prioritäten lauten, und wenn die Arbeitslast gleich verteilt wird. Was bedeutet all das nun für das Thema „Hybride Arbeit“?
Sie muss „orchestriert“ werden. Es gilt, klar zu kommunizieren. Leitplanken festzulegen, die zunächst die Aufgaben und Anforderungen in den Mittelpunkt stellen, und bei denen anschließend die individuellen Präferenzen der Teammitglieder berücksichtigt werden. Es muss allen klar sein, welche Regelungen gelten und wie sie entstanden sind.
A/B-Test anwenden
Beim chinesisches Konzern Trip.com sieht man die Sache ähnlich: Wichtig sind klare Vorgaben von oben. Dort ist man einen interessanten Weg gegangen. Mitarbeitende konnten sich freiwillig an einem Experiment beteiligen. Die Hälfte von ihnen ging ein halbes Jahr jeden Tag ins Büro, die Versuchsgruppe jeden Montag, Dienstag und Donnerstag (Heimvorteil). Ergebnis: Die Führungskräfte, die vorher vermutet hatten, dass die Produktivität sinken würden, gaben anschließend an, dass sie bei der Versuchsgruppe sogar gestiegen sei. Tatsächlich war sie bei beiden Gruppen gleich. Allerdings wies die Versuchsgruppe eine deutlich höhere Zufriedenheit auf und die Fluktuation sank um 35%.
Zwei weitere Tipps, die auch in einem weiteren Beitrag (Wenn Freiheit lähmt) genannt werden: Es braucht ein klares Bekenntnis des Top-Managements (wo braucht es das nicht?) und eine passende Leistungsbeurteilung. Bei Trip.com klingt das Instrumentarium klassisch: Eine mehrdimensionale 5-Punkte-Skala, wobei auch Kunden- und Kollegen-Feedback einfließen. Von der Bewertung sind auch die Boni abhängig.
So sehen es auch Cappelli und Nehmeh. Wobei diese zusätzlich empfehlen, als Beurteilungskriterium auch aufzunehmen, wie die Mitarbeitenden mit Kolleginnen kooperieren und wie sie Neulinge einarbeiten. Steuerung über Kontrolle, Bewertung und Belohnung – ob das gut geht?
Komplexe Regelwerke
Noch einmal zu den klaren Regeln: Da ist offenbar noch viel Handlungsbedarf. Bei GitLab, wo komplett remote gearbeitet wird, soll das Regelwerk mehrere 100 Seiten umfassen. Was könnte darunter fallen? Beispiele sind: Wann soll auf Nachrichten sofort reagiert werden? Schließlich kann man nicht mal eben den Kollegen am Schreibtisch gegenüber fragen und sofort eine Antwort erhalten. Was passiert, wenn Fragen als dringend gekennzeichnet sind, sie es aber nicht sind? An welchen Zeiten möchten Kolleg*innen nicht gestört werden, wann darf man sie ansprechen? Müssen bei Meetings die Kameras immer eingeschaltet sein?
Guter Hinweis: Die Regeln sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf geändert oder wieder abgeschafft werden. Das ist grundsätzlich eine gute Idee, vielleicht schrumpft dann auch das Handbuch mit hunderten Seiten wieder …