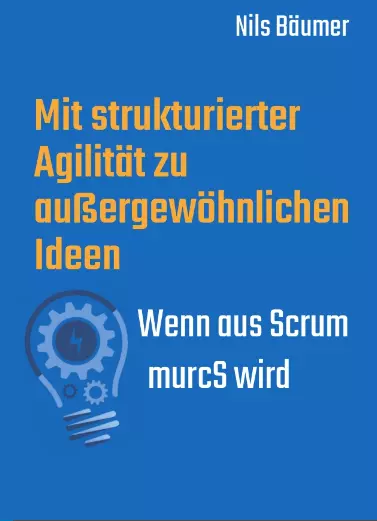KRITIK: Scrum ist eine höchst effektive Art, Projekte abzuwickeln und dabei vor allem flexibel auf sich ständig ändernde Anforderungen zu reagieren. Aber auch wenn Scrum häufig in einem Zusammenhang mit Design Thinking genannt wird – eine Kreativitätsmethode ist Scrum nicht. Beide Ansätze zeigen Merkmale von Agilität – eben genau die Möglichkeit, Ergebnisse immer wieder zu hinterfragen, Kundenwünsche zu berücksichtigen, Ergebnisse zu testen und die Erkenntnisse sofort wieder zu nutzen, um das Produkt zu optimieren.
Während Design Thinking Raum und Zeit für das Entwickeln neuer Ideen lässt, aber weniger stark in Sachen Umsetzung ist, hat Scrum gerade hier seine Stärken. Nur fehlt dabei eben genau das: Raum und Zeit, um wirklich kreativ zu sein. Stellt Nils Bäumer in der managerSeminare fest (Einfach murcS machen). Und schlägt ein Workshop-Format vor, das er „murcS“ nennt und das sich an Scrum anlehnt. Es ermöglicht, neue Ideen zu entwickeln ohne den unmittelbaren Ergebnis- und Umsetzungdruck.
Anzeige:
Weiterbildung zur agilen Change Managerin für fundiertes Wissen und praktische Relevanz ohne Berater Bla-Bla. Lernen Sie klassische Change Methoden mit neuen agilen Praktiken zu verbinden. In Kooperation und mit CAS Zertifikat der Hochschule Bremen. Hybrides Lernkonzept, d.h. Präsenz- und Remote Module wechseln sich ab.
Infos und Buchung hier

Workshop
Die von Scrum und Design-Thinking entliehenen Elemente dieses ein- bis zweitägigen Workshops sind folgende:
- Teilnehmer: Gut ist ein bunt gemischtes Team aus fünf bis sieben Mitgliedern. Die Teilnehmer sollten unterschiedliche Lebenswege haben. Aus den betroffenen Bereichen sollten Vertreter anwesend sein, oder Kunden und Experten, gerne auch von extern.
- Der Product Owner wird hier zur Hebamme für Ideen. Er sollte gut vernetzt mit den Entscheidungsträgern sein und daher die Umsetzung unterstützen können. Er kennt zwar die Lösung nicht, aber er sollte eine Vision des Zielzustandes haben. Also das Problem gut kennen und wissen, „wie die Welt aussieht, wenn die Lösung da ist“. Um dahin zu gelangen, kann er sich vorher der bekannten Analysetechniken aus dem Design Thinking bedienen.
- Analog zum Scrum Master hat ein Teilnehmer die Aufgabe, den Workshop zu organisieren, sich um Verpflegung, Arbeitsmaterialien und Methoden und Techniken zu kümmern. Erinnert an einen klassischen Moderator.
- Sprint der Ideen: Wie bei Scrum gibt es in dem Workshop mehrere Sprints, je nach Dauer bis zu vier. Am Anfang eines Sprints wird geplant: Was ist das Problem, was ist das Ziel, welche Techniken wollen wir einsetzen in welcher Reihenfolge? Auch wird definiert, wann das Ziel als erreicht gilt. Welche Kreativitätsphasen eingesetzt werden, ist dem Team überlassen. Da auch hier der Zeitrahmen streng begrenzt ist, besteht nicht die Gefahr des Ausuferns.
- Die Dailys (das tägliche Treffen, bei dem die Teilnehmer die bisherigen Ergebnisse präsentieren und das weitere Vorgehen planen) werden zum Thing. Das sind zeitlich strikt limitierte Stand-ups, bei denen die Teilnehmer sich auf den neusten Stand bringen. Das dauert maximal zehn Minuten, dann geht es weiter.
- Vom Review zum Pitch: Am Ende eines Sprints werden die Ideen präsentiert. Hier sollte es vor allem darum gehen, Begeisterung zu wecken, ansonsten haben die Ideen wenig Chancen auf Realisierung. Also sollte sich das Team überlegen, wie die Ideen präsentiert werden, so dass die Entscheidungsträger überzeugt werden können.
Klingt nachvollziehbar. Wobei ich mir die Frage stelle, wo genau der Vorteil eines solchen Workshop-Konzeptes liegt? Und warum man nicht das Design-Thinking-Konzept anwendet? Vielleicht, weil die Teilnehmer das Vorgehen gewohnt sind?