INSPIRATION: Miteinander statt gegeneinander, lautet die Botschaft: KI muss nicht zum Digitalen Taylorismus führen. Gut implementiert können KI und Mitarbeitende die Arbeitsgestaltung verbessern. Aber dafür will so einiges bedacht sein.
Das Thema Arbeitsgestaltung und KI hatten wir gerade erst auf dem Schirm (Wenn der Kopilot übernimmt …). Wenn KI Beschleunigung und Effizienz bringt, darf der Blick auf die psychischen Auswirkungen nicht fehlen. Oder sagen wir es noch deutlicher: Digitaler Taylorismus (Digitale Strippenzieher) muss vermieden werden. Die erste Priorität muss in Einklang mit den fundamentalen Erkenntnissen der Arbeitspsychologie heißen: menschengerechte Arbeit, nicht maschinengerechte.
Anzeige:
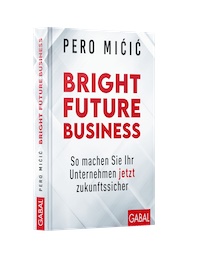
Die Autorinnen (AI and work design) untersuchen die Einführung von Künstlicher Intelligenz (KI) in Arbeitsprozessen und deren Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Mitarbeitenden mittels des PERMA-Modells der Positiven Psychologie (Positiv, selbstbestimmt und sinnvoll). Das Akronym PERMA bedeutet ins Deutsche übersetzt: Positive Emotionen, Engagement, Beziehungen, Sinn und Zielerreichung. Warum das sinnvoll ist? Weil herkömmliche Ansätze zur Einführung von KI häufig lediglich extrinsische Faktoren wie Produktivität und Benutzerfreundlichkeit in den Vordergrund stellen. Intrinsische Faktoren werden eher vernachlässigt.
Doch die Integration von KI in Arbeitsprozesse verändert grundlegend die Aufgabenbereiche, Anforderungen und auch Organisationsstrukturen. Es verändert sich für die Mitarbeitenden ihre wahrgenommene soziale Rolle am Arbeitsplatz. Damit verbunden stellen sich Fragen nach Wachstumschancen (Potenzialentwicklung) oder solche in Bezug auf Dequalifizierung und verminderte Autonomie.
Proaktives Arbeitsdesign
Vor einiger Zeit haben Parker und Grote (2022) schon einen Rahmen für proaktives Arbeitsdesign bei der Implementierung neuer Technologien vorgeschlagen. Sie identifizieren vier Schwerpunktbereiche: Prinzipien des Arbeitsdesigns, menschenzentrierte Technologieentwicklung sowie organisatorische und individuelle Faktoren.
Andere Forscher verwiesen auf die Selbstbestimmungstheorie (SDT) von Ryan und Deci (2000). Diese Theorie geht davon aus, dass drei grundlegende psychologische Bedürfnisse, nämlich Autonomie, Kompetenz und Verbundenheit, für die intrinsische Motivation und das Wohlbefinden unerlässlich sind.
Ein umfassenderes Rahmenwerk
Alles gut und schön, so die Forscherinnen (AI and work design), doch zu kurz gesprungen: Es braucht ein umfassenderes Rahmenwerk. Und hier kommt PERMA ins Spiel. Sie erweitern das Modell von Parker und Grote (2022), indem sie die PERMA-Dimensionen des Wohlbefindens explizit in die Diskussion über KI und Arbeitsgestaltung einbeziehen. Dazu führten sie eine narrative Literaturrecherche durch. Es ging ihnen dabei um die Integration von KI in Arbeitsumgebungen und deren Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter.
Und siehe da, am Ende steht ein „verfeinertes Rahmenwerk für die Arbeitsgestaltung“. KI-Systeme, so zeigen die Ergebnisse der narrativen Literaturrecherche, haben das Potenzial, Arbeitsplätze zu schaffen, die das psychische Wohlbefinden fördern, indem sie repetitive Aufgaben reduzieren, das Gefühl der Sinnhaftigkeit der Mitarbeiter unterstützen und den Aufbau von Beziehungen trotz räumlicher Trennung verbessern. Entpersonalisierung, Desengagement und vermindertes Leistungsgefühl kann verhindert werden. Und wie geht das?
Positive Emotionen
Wenn repetitive Aufgaben automatisiert und kognitive Belastung reduziert werden, kann das positive Emotionen verstärken. Dafür sollten KI-Systeme aber Benutzerfreundlichkeit, Transparenz und Möglichkeiten zur Personalisierung in den Vordergrund stellen, beispielsweise mittels interaktiver Dashboards. Wenn personalisiertes Feedback gegeben wird und individuelle Beiträge erkennbar sind, fördert das das Gefühl von Wertschätzung und Optimismus.
Engagement
KI-Systeme sollten nicht die Autonomie oder Kreativität der Mitarbeitenden einschränken. Dazu neigen beispielsweise präskriptive, KI-gesteuerte Systeme zur Aufgabenverteilung. Unternehmen sollten eine Kultur des Vertrauens und der Transparenz pflegen.
Beziehungen
Es darf keine unpersönliche Arbeitsumgebung entstehen, in der sich die Mitarbeiter isoliert fühlen. KI-Systeme haben auch das Potenzial, den Aufbau von Beziehungen zu verbessern, indem sie eine bessere Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern ermöglichen. Wenn beispielsweise Plattformen für den Wissensaustausch und die Zusammenarbeit im Team bereitgestellt werden. Die Mitarbeitenden müssen sich gesehen und gehört fühlen.
Sinnhaftigkeit
Wenn KI-Systeme Verantwortlichkeiten delegiert, ohne zu kontextualisieren, wie diese Aufgaben zu übergeordneten Zielen beitragen, kann Entfremdung das Ergebnis sein. Wenn KI-Systeme den Mitarbeitenden Einblicke ermöglichen, wie ihre Beiträge mit den übergeordneten organisatorischen oder gesellschaftlichen Zielen in Einklang stehen, beispielsweise über KI-gestützte Dashboards, kann das das Sinnerleben steigern.
Leistung
Eine übermäßige Abhängigkeit von KI bei komplexen Aufgaben kann die Möglichkeiten der Mitarbeiter einschränken, kritisches Denken und Problemlösungsfähigkeiten zu entwickeln. Das wird ihr Verantwortungsbewusstsein mindern. Unternehmen sollten KI-Tools einsetzen, die die Fähigkeiten der Mitarbeiter ergänzen und ihnen gleichzeitig Möglichkeiten für Wachstum und kritisches Engagement bieten. Das sollte deren Erfolgserlebnis fördern.
Fazit
Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung lediglich um einen, wenn auch durch qualifizierte andere Literatur unterstützten, Rahmen. Man sollte das nicht überbewerten. Die Botschaft klingt positiv, wenn auch manchmal etwas oberflächlich. Daher muss man einfach feststellen: Die richtige Arbeit, nämlich die empirische Überprüfung dieses Modells, wartet noch auf die Autorinnen …




