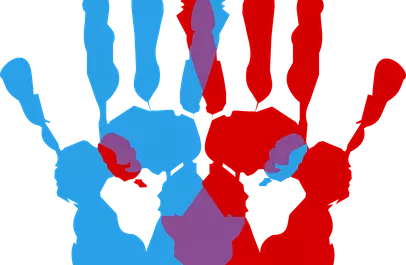INSPIRATION: Die sozialen Medien sind Plattformen für Selbstdiagnosen geworden. Nicht nur für körperliche, sondern auch für psychische Erkrankungen. – Der Segen der „Demokratisierung“ führt aber zugleich den Fluch im Schlepptau.
Depressionen, ADHS, Zwangsstörungen und so weiter: Immer mehr Zeitgenoss:innen empfinden sich als neurodivers. Wer beginnt, daran zu zweifeln, dass er noch ganz normal ist, wer befürchtet, dass irgendwas mit ihm oder ihr nicht stimmt, muss nur Google befragen. Oder diverse Social-Media-Kanäle konsumieren. Und Schwupps: Gestern noch normal, heute schon schwerstkrank!
Anzeige:
Veränderungen gemeinsam bewusst zu gestalten und das komplexe Zusammenwirken aller Beteiligten wirksam zu verzahnen, damit sie ein Unternehmen voranbringen - dabei begleitet Gabriele Braemer mit clear entrance® seit über 20 Jahren Organisationen rund um den Globus. Mit strategischem Know how, methodischer Vielfalt und einem echten Interesse für Ihr Anliegen. Zur Webseite...

Man gibt ein paar Symptome bei Youtube & Co. ein, so die Autorin (Wie neurodivers darfs denn sein?) und schon erklärt einem ein Selbstbetroffener, Influencer oder wie sich sonst irgendwelche Menschen nennen mögen, die dort posten/senden, in einem Video, was „man hat“. Das mag für die eine die Erkenntnis, eine Erleuchtung sogar sein. Vielleicht auch eine Entlastung: Endlich hat das „Kind“ (Unwohlsein) einen Namen. Ich kann ja nichts dafür, so die Überzeugung, ich bin halt so, man muss mich so nehmen wie ich bin. Für andere ist es eine Entschuldigung, ein Freibrief gar.
Oder eine Auszeichnung! Gestern war ich ein Normalo. Heute bin ich etwas Besonderes! Und vielleicht ist es sogar eine Einladung, in den Club der XY einzutreten, sich solidarisch zu zeigen, die Gruppe zu unterstützen – nach innen, aber auch nach außen. Gegen die „Ignoranten“ sich zu positionieren, für Respekt, Anerkennung und Verständnis zu werben. Vielleicht werden sogar gesellschaftspolitische Forderungen an die Erkenntnis der (neuen) Identität geknüpft …
Laiendiagnose
Was dann schnell passiert: Man stellt sich (gegenseitig) eine Laiendiagnose, lässt sie nicht vom Experten abklären – und im schlimmsten Fall immunisiert man sich auch noch gegen Kritik. Dabei ist man bloß ein Schlauberger; ein selbsternannter.
Damit keine Irritationen entstehen: Ich kenne das. Als Allergiker habe ich mich zeitlebens mit Anfeindungen meiner Umwelt auseinandersetzen müssen. Ich habe den anderen den „Akkord kaputt gemacht“, weil ich im Frühjahr kaum aus den Augen gucken konnte, also nicht so leistungsfähig war wie die Normalos. Das hat mich auch eigene Lebens(arbeits)zeit gekostet.
Und ich kenne auch die Selbsthilfegruppenszene, die Verzweiflung von chronisch Kranken oder (noch schlimmer) von Müttern kleiner Kinder, die nicht nur um den Schlaf gebracht wurden. Sondern die „nervlich“ am Ende waren. – Alle auf der Suche nach Heilung …
Die sie oftmals im schulmedizinischen System nicht fanden – oder mit dessen Nebenwirkungen haderten. Und die sie deshalb im naturheilkundigen Bereich suchten. Oder im Esoterischen. Jeden Strohhalm ergreifend … Es könnte ja etwas bringen. Oder die von Familien, Freunden, Arbeitskolleg:innen bedrängt wurden: Probiere doch mal XY! Meinem Bekannten hat’s geholfen. „Wie? Willst Du nicht? Glaubst Du nicht dran? Hast es ja noch gar nicht probiert! – Also, so schlimm kann es ja nicht sein bei Dir … aber vielleicht ist es ja auch Psycho …“. Und der Vollständigkeit halber muss erwähnt werden: Nur zirka 50% der Hausärzte erkennt klinisch bedeutsame Depressionen (Die Diskussion über die Zunahme psychischer Störungen und die Rolle der Arbeit). Den Querverweis auf Heilung, Erlösung, also auf den Bereich Religion, erspare ich meiner Leserschaft an dieser Stelle.
Das Gute im Schlechten – und andersherum
Dass wir heute sensibler geworden sind für Differenzen und Differenzierungen, finde ich gut. Und das daraus Maßnahmen erwachsen: dito. Ich frage mich allerdings, ob sich da inzwischen nicht ein Trend zur Übertreibung erkennen lässt. Das Thema hinter dem Thema scheint für mich „Identität“ zu lauten: Raus aus dem Sumpf der Masse, hin zur Einmaligkeit. – Kleiner Seitenhieb: Nach der Inklusion kommt die Exklusivität. „What comes up, must come down,“ sangen The Byrds (Turn, turn, turn); übrigens ein Bibelvers. Und da fehlt methodisch bloß noch die „Heldenreise“ (Integratives Persönlichkeitscoaching). Mein Kommentar dazu in aller Kürze: David Bowie – Heroes.
Die Autorin seziert das Thema Neurodiversität differenziert. Sie verweist auf die Vorteile, die Enttabuisierung, die Abkehr von den Defiziten, die Weitung der Perspektive. Aber sie beschreibt auch die Übertreibung: Überpathologisierung und die Verzerrung der Wahrnehmung. „Wer noch keine Diagnose hat, hat sich bloß noch nicht richtig mit den eigenen Symptomen auseinandergesetzt.“ Und: „Wenn die Abweichung zur Norm geworden ist, gilt es nicht, die geltenden Vorstellungen von Norm zu überdenken?“ – Was ist damit gewonnen, wenn wir feststellen, dass jeder Mensch einzigartig ist? Alles und nichts. Denn die einzigartigen Menschen haben auch sehr viel gemeinsam.
Selbstdiagnostik
In der professionellen Diagnostik hakt man nicht eine Checkliste an Symptomen ab und fällt dann sein „Urteil“. Diagnostiker wissen, es gibt falsch positive und falsch negative Befunde (s. Personalauswahl: Die Guten laufen lassen, die falschen einstellen). Daher wird der „Patient“ und seine Lebenssituation gewissenhaft mittels verschiedener Methoden exploriert. Dabei bedient man sich auch nicht plumper Heuristiken (Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen), sondern eher der Beschreibung von Tendenzen. Ein weiterer Vergleich zur Personalauswahl: Statt unbrauchbarer Typenschubladen (z.B. MBTI) nutzt man Polaritäten (z.B. Big 5).
Die Selbstdiagnostik hingegen ist in der Regel naiv. Was nicht weiter wundert. Es fehlt halt die entsprechende Vorbildung. Daher funktioniert die Selbstdiagnostik eher stereotyp. Man kann das mit dem Glauben an die Astrologie vergleichen: Wem sein Sternzeichen und die damit angeblich zusammenhängenden Eigenschaften offenbart werden, betont die Zusammenhänge und relativiert die Unterschiede (Eklektizismus). Dazu trägt bei, dass solche Beschreibungen eher vage gehalten sind. Dann denkt man sich halt seinen Teil. Das Ergebnis ist eine fulminante, selbsterfüllende Prophezeiung.
… und Fremdhilfe
Die sich damit einstellende 100%-ige Überzeugung, dass man „das jetzt habe“, ist natürlich oftmals ein gefundenes Fressen für kommerzielle Anbieter: Puder, Pillen, Salben – oder für die Psyche: Bücher, Videos und Wellbeing-Workshops – lassen sich da leicht an die Frau oder den Mann bringen. Umso leichter übrigens, wenn auch „von oben“ seit etlichen Jahren „die Latte“ für Krankheit immer tiefer gehängt wird. Allen Frances, ein renommierter US-amerikanischer Psychiater und Mitautor des in den USA maßgeblichen DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5. Aufl.) warnte schon vor zehn Jahren vor einer inflationären Ausbreitung psychiatrischer Diagnostik, die aus Gesunden potenziell Kranke mache (Eine entfesselte Diagnose-, Test- und Therapiewut). So nach dem Motto: „Ihr Kind ist sehr lebhaft? Dann hat es bestimmt eine Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS). Ergo braucht es ein Medikament wie Ritalin. Das wird es ruhiger machen – ist auch besser für Ihre Nerven …“.
Wo kommt der Hype her? Sollen wir ihn mit VUCA oder Covid-19 erklären? Alles recht gewagte Hypothesen. Einfacher ist es, seine Funktion zu beschreiben: Unerwünschte und unangenehme Gefühle können damit exkulpiert werden. Man muss sich damit nicht mehr auseinandersetzen, man attribuiert sie auf die Störung/Krankheit. Selbsterfahrung, Lernen, Wachsen an der Verarbeitung … warum? Man wirft die „Pille“ der Diagnose ein, die Schmerzen schwinden. Wie sagte Wilhelm Busch so schön: „Wer Sorgen hat, hat auch Likör“ („Die fromme Helene“).
Herausforderungen für Führung, Kultur und BGM
Unternehmen erleben den Hype um Neurodiversität vermutlich als Herausforderung. Einerseits will man Diversität hochhalten. Andererseits fühlt man sich leicht überfordert. Der BGM-Experte sieht sich mit selbsternannten Expertinnen in eigener Sache konfrontiert. Führungskräfte sind verunsichert … Es dürfte vermutlich schnell Einigkeit darüber herzustellen sein, dass solche Eigendiagnosen einer professionellen Abklärung bedürfen – und nicht für sich alleinstehen können.
Was nicht bedeutet, dass solches unbedingte Akzeptanz bei den Betroffenen findet. Der scheinbar leichte Zugang zu Informationen im Internetzeitalter geht mit einer Deprofessionalisierung, also einer Abwertung der etablierten Professionellen, einher. Nicht nur in diesem Bereich, wie man gesamtgesellschaftlich immer wieder beobachten kann. Doch Information ist noch lange kein belastbares Wissen. Auch wenn Otto Normalverbraucher „es“ schließlich im Internet gelesen hat. Und doch lässt sich derzeit – durch die Bank – ein Machtverlust der etablierten Institutionen registrieren. Gar mancher Halbgebildete hält sich für schlauer als er ist. In der Wissenschaft als Dunning-Kruger-Effekt bekannt (Fatales Unwissen bei strotzendem Selbstbewusstsein).
Und Unternehmen werden sich auch fragen, ob sie wegen der Extravaganzen auf die ansonsten möglicherweise hochkompetenten Mitarbeitenden (leichtfertig) verzichten wollen. Keine einfache Lage.