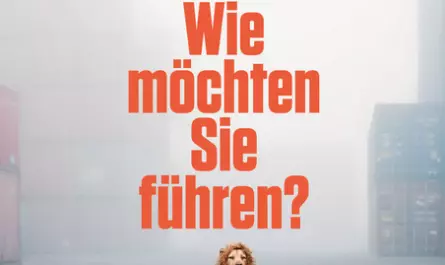PRAXIS: Nicht nur bei gescheiterten Projekten, ganz allgemein nach einer „Scheitererfahrung“ möchte man am liebsten zur Tagesordnung übergehen und einen Mantel des Schweigens über die Geschichte breiten. Wer sich damit nicht abfinden möchte, der nimmt sich ein Blatt Papier und macht sich zu folgenden Aspekten Notizen, um „Das Gute im Schlechten“ zu finden:
- Unsere Scheitererfahrung
- Was ist genau passiert?
- Wer war beteiligt?
- Was haben wir empfunden?
- Die andere Seite (es ist ja nie immer alles schlecht gelaufen)
- Was ist trotz des Scheiterns gelungen?
- Auf was können wir trotz des Scheiterns stolz sein?
- Welche Fähigkeiten konnten wir durch die besondere Situation aktiviert entwickeln, die wir bisher wenig genutzt haben?
- Schwache Signale: Meist kündigt sich ein Scheitern ja im Vorfeld an, nur übersehen bzw. überhören wir die Hinweise. Um unsere Wahrnehmungsfähigkeit zu stärken:
- Welche inneren und äußeren Signale kündigten das Scheitern an?
- Was haben wir getan, um diese Signale zu überhören?
- Das unerreichte Ziel – wer scheitert, der hat sein Ziel nicht erreicht. Vielleicht lag das Scheitern auch am Ziel selbst (zu anspruchsvoll, ein Zielkonflikt mit einem impliziten Ziel…)
- Was wollten wir ursprünglich erreichen?
- Was wollen wir jetzt erreichen?
(aus: Martin Gössler: Die Kunst des Scheiterns, Organisationsentwicklung 01/2007, S. 10)
Anzeige:
Was ist das eigentlich: Professionelles Coaching? Erfährst Du in meinem Podcast. Er heißt „eindeutig Coaching“ und ist das Richtige für Dich, wenn Du Coaching für Dich selber und in Deiner Arbeit nutzen willst. Hör rein! Findest Du überall, wo es Podcasts gibt. Viele Grüße! Margot Böhm. Mehr Infos hier