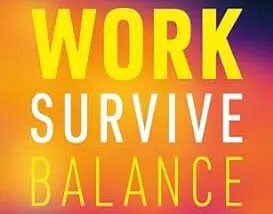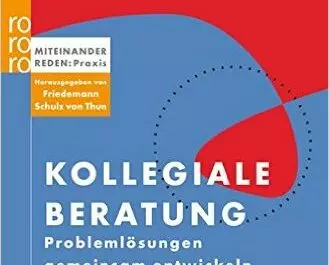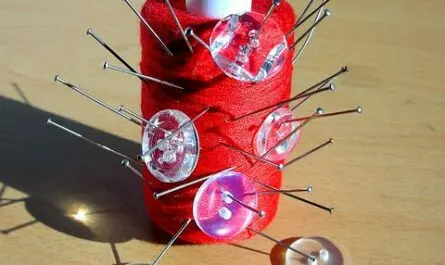REZENSION: Hans Rusinek – Work Survive Balance. Warum die Zukunft der Arbeit die Zukunft unserer Erde ist. Herder 2023.
Work-Life-Balance: Den Begriff kennt inzwischen vermutlich jede/r. Dass er missverständlich ist, sollte sich auch längst herumgesprochen haben. Denn Arbeit ist – vermutlich mehr als – das „halbe Leben“. Das, was mit Balance intendiert sein mag, nennen wir heute präziser „Grenzmanagement“. Denn das Verwischen dieser Grenze durch ständige Erreichbarkeit, aber auch durch Homeoffice, und die Effekte dessen für die psychische Gesundheit, ist in der Tat ein wichtiges Thema. Wenn ich auch gerne daran erinnere, dass das Thema Work-Life-Balance ein recht neues ist. Man schaue nur einmal hundert Jahre zurück auf Zehn-Stunden-Arbeitstage in der Industrie.
Anzeige:
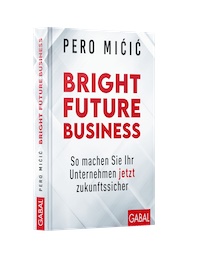
Autor Hans Rusinek stimmt in diese Argumentation ein: Der Begriff „hindert uns daran, uns Arbeit als einen lohnenden Teil des Lebens vorstellen zu können“. Und er dreht die Diskussion: „Wie lässt sich denn eine Balance in der Arbeit selbst finden?“ Dann bringt er sein Anliegen auf den Punkt: Es geht ihm um eine Balance aus Ökonomie und Ökologie. Das meint der Titel „Work Survive Balance“. Und er konstatiert, dass sich heute eine grundsätzliche Unzufriedenheit in und mit der Arbeit beobachten lasse. Weniger, dass die Zeitgenossen überhaupt keine Lust mehr auf Arbeit hätten. Sondern eher so, dass immer mehr Menschen wenig Lust auf diese Art von Arbeit haben, die sie derzeit verrichten.
Die große Unzufriedenheit
Was ist da los? Warum besteht diese latente Unzufriedenheit? Unter „Die Herausforderung“ geht es in drei Kapiteln um eine Diagnose. Es geht, so wird immer mehr Zeitgenossen klar, um die Zukunft des Planeten. Unsere Art des Arbeitens – immer höher, schneller, weiter – stammt aus der Steinzeit. Und sie hat uns dahin gebracht, wo wir heute stehen: an den ökologischen Abgrund. Wunderschön bringt der Autor das mit einer Metapher auf den Punkt, wenn er das Gemälde von Francisco de Goya bespricht. Im „Knüppelkampf“ prügeln zwei Männer aufeinander ein – und versinken dabei immer weiter im Treibsand (Die Zukunft der Arbeit ist die Arbeit an der Zukunft). Oder andersherum ausgedrückt: Wir verfrühstücken unsere Zukunft. Weil wir nicht nachhaltig wirtschaften. Wir Dinosaurier. Und die Ausreden und Beschwichtigungen, die wir heute oft hören – New-Work-Romantik würde uns retten, Wishful-Thinking oder neue Technologien und Innovationen – alles viel zu kurz gesprungen. Wir brauchen eine Mischung aus Mindset, Skillset und Toolset. Nun, ich mag solche Begriffe nicht. Aber schauen wir uns zunächst einmal an, welche Veränderungsdimensionen Hans Rusinek der Leserschaft kapitelweise vorstellt:
- Haltung – ein neues Menschenbild. Der Mensch als Produzent und Konsument, das steckt viel zu tief in uns drin, so Rusinek, der (löblich!) auf die Philosophie von Hannah Arendt Bezug nimmt. Daher sind wir in der Wegwerfgesellschaft gelandet. Wir müssen politisch handeln und die Zukunft enkeltauglich gestalten.
- Organisationsverständnis – weg von der Maschinenlogik. Die Ökonomik muss sich als Teil der Sozialwissenschaften verstehen. Und ökologisch denken.
- Anerkennung – Gemeinschaft leben. Die Spaltung in Akademiker und Handwerker, in Kognition und Emotion, in Management und Hilfsjobs ist unproduktiv. So wird Potenzial vergeudet. Nicht Supermen werden die Welt retten, sondern Pluralismus und Partizipation (Soziodiversität).
- Intelligenz(en) – für einen digitalen Humanismus. Die Künstliche Intelligenz ist weder künstlich noch intelligent: „nicht künstlich, weil die zugrundeliegenden Datensätze von Menschen stammen, mit allen Verzerrungen, die dabei entstehen. Nicht intelligent, weil diese Datensätze rein mit Mechanismen der Statistik aufbereitet werden.“ Wir brauchen eine Ökologische Intelligenz (ÖI): „Die ÖI ist die Intelligenz des Lebens selbst.“
- Sinn – Arbeit vom Ende her denken: Zusammenarbeit. Weg von der Selbstverwirklichungsprosa, „der Kern der Arbeit ist das Soziale.“
- Zusammenhalt – weg von falschen Generationenkonflikten. Intergenerativem Zusammenarbeiten gehört die Zukunft. „Die Ausprägung der Bedürfnisse mag sich wandeln, die Grundbedürfnisse dahinter verbinden uns aber alle.“ Jugendwahn und Altersdiskriminierung sind Energieverschwendung.
- Zeit – raus aus dem Hamsterrad. Wir leben in einer „Zuvielisation“, in einem rasenden Stillstand. „Alles ist möglich, aber nichts geht mehr.“ Es gilt, das Zyklische der Zeit wiederzuentdecken. Und die chronobiologische Diversität.
- Sichtbarkeit – wir brauchen ein umfassendes Arbeitsverständnis. Care-Arbeit ist ein blinder Fleck. „Beide Regenerationssysteme, ob Natur oder Care, werden nicht angemessen bepreist und daher auch nicht in ihren Leistungsgrenzen wahrgenommen.“
- Körper – die Halbierung der Welt überwinden. Die Abwertung des Körperlichen, ein Erbe der Religion und der Philosophie, hat uns zu Invaliden gemacht. Die Neurowissenschaften lehren inzwischen, wie wichtig Embodied Cognition sind.
Was ist das Fazit? „Dies Buch ist kein Ratgeber,“ so der Autor. Ich bekenne, ein wenig mehr hätte ich mir schon gewünscht. Thomas Sattelberger, dessen Buch „Radikal neu“ (Nach uns die Sintflut?) ich fast zeitgleich gelesen habe, ist da deutlich klarer. Er ruft (nicht nur) die junge Generation dazu auf, sich in die Selbstständigkeit zu trauen, sich mit Gleichgesinnten zusammen zu tun und in innovatives Geschäft zu investieren. Solches fehlt bei Rusinek. Zum Schluss entlässt er seine Leserschaft mit einem „Manifest der enkeltauglichen Arbeit“.
Rusineks Buch ist leicht und locker zu lesen. Immer wieder witzig und erfrischend. Der Autor ist belesen. Die Botschaft ist klar und wird fundiert dargelegt. Für meinen Geschmack hätte ich mir mehr wirtschaftspsychologische Expertise vom Ökonomen Rusinek gewünscht. Das schmerzt vor allem zum Schluss beim Thema Körper. Hier irrte Descartes, sagte schon António Damásio in den 1990ern. Konsequenter wäre es daher, von Leib statt Körper zu sprechen (res extensa heißt es entlarvender Weise beim französischen Philosophen). Mit der Forschung zu Embodiment (Die Rückkehr der Gefühle) sind wir schon um Längen weiter als Autor Rusinek mit dem Hinweis auf Embodied Cognition andeutet. Andererseits richtet sich sein Buch an ein Massenpublikum. Insofern will ich hier mal nicht zu streng sein.
Doch die Frage bleibt offen: Wie kommen wir von der Programmatik zur Veränderung? Reicht dafür eine Lesereise? Reicht es, das Manifest an irgendeine (und wenn ja, welche?) Kirchentür zu nageln? Ich persönlich würde mir da mehr wünschen.