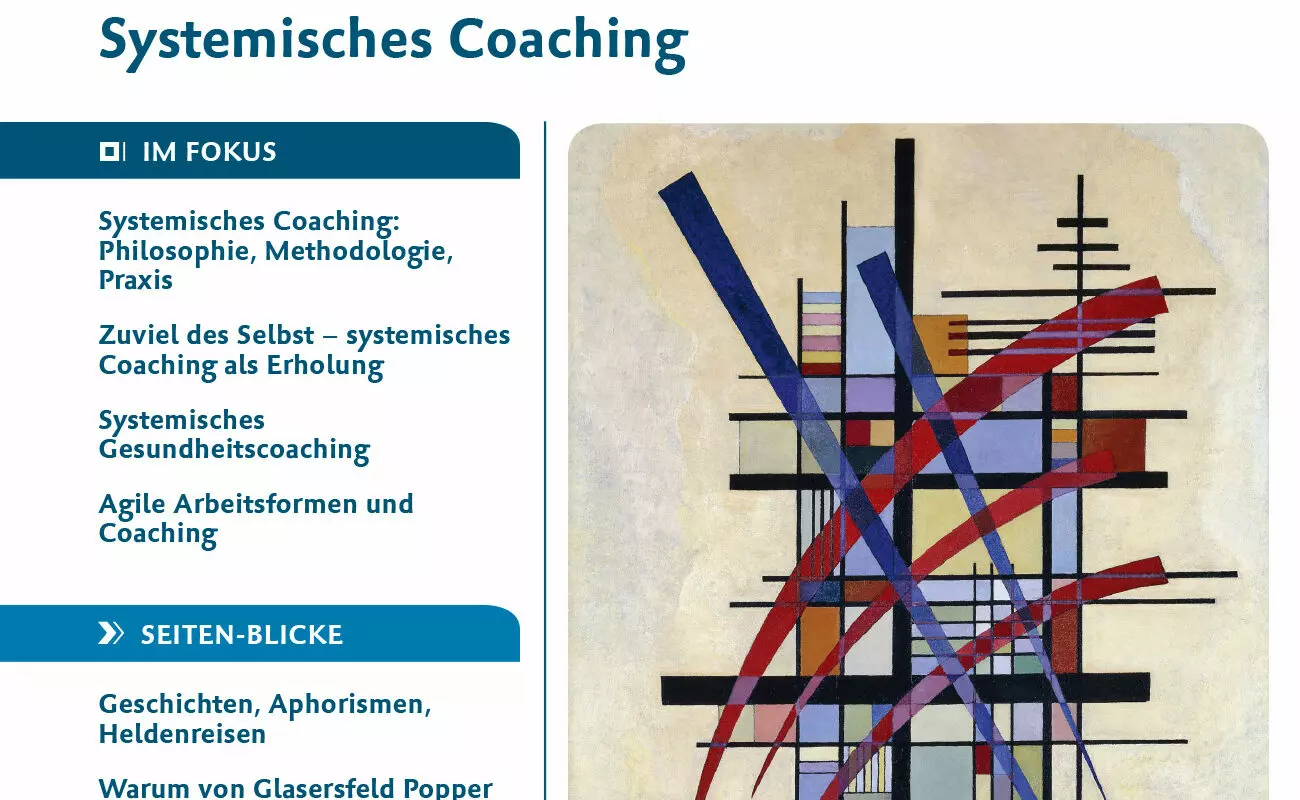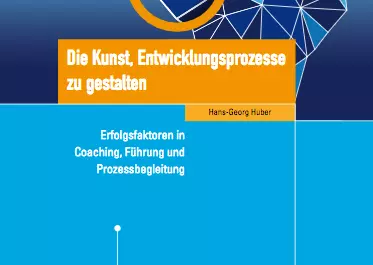INSPIRATION: Dr. Hans-Rudi Fischer, Philosoph und Psychologe vom Heidelberger Institut für systemische Forschung, gehört zu den hellen Köpfen in der Szene systemischen Coachings. Und ist dort seit Jahrzehnten ein Key Player – u. a. als langjähriger Mitherausgeber der Zeitschrift Familiendynamik. Wenn folglich jemand wie er ein Schwerpunktheft „Systemisches Coaching“ lanciert, lässt das aufhorchen.
Er lässt sich auch gar nicht lange lumpen und geht sogleich kritisch ans Werk. Neben einem eigenen Beitrag zu philosophischen, methodischen und praktischen Grundlagen (Systemisches Coaching) findet man im Heft noch drei weitere Beiträge: Frank Dievernich apostrophiert ein „Zuviel des Selbst“. Stefan Hölscher bemüht sich, die Herausforderungen agiler Arbeitsformen fürs Coaching heraus zu arbeiten. Und Matthias Lauterbach beschreibt zum wiederholten Male, was er seit vielen Jahren erfolgreich unter dem Label systemisches Gesundheitscoaching praktiziert.
Anzeige:
Was ist das eigentlich: Professionelles Coaching? Erfährst Du in meinem Podcast. Er heißt „eindeutig Coaching“ und ist das Richtige für Dich, wenn Du Coaching für Dich selber und in Deiner Arbeit nutzen willst. Hör rein! Findest Du überall, wo es Podcasts gibt. Viele Grüße! Margot Böhm. Mehr Infos hier

Fischers Beitrag ist der wirklich interessante und inspirierende Beitrag in diesem Schwerpunkt. Gleich zu Beginn konstatiert er, systemisch als auch Coaching seien „semantische Vagabunden“. Begriffe folglich, von denen niemand so genau wisse, was sie bedeuten sollen. Oder Begriffe, die gar bunt und recht unterschiedlich interpretiert würden. Nun, diese Kritik ist nicht neu. Inspirierend allerdings ist die kleine philosophische Reise, auf die der Autor die Leserschaft mitnimmt. Diese beginnt bei Heraklit (ca. 500 v. Chr.): alles fließt, der Streit als Vater aller Dinge. Das Prozesshafte, die Interaktion, Raum und Zeit kommen hier ins Spiel. Es ist ein zyklisches, zirkuläres Weltbild, das der alte Grieche zeichnet. Hierarchische Ansprüche und Steuerungsabsichten erscheinen absurd. Ein Coach kann hier nur Reisebegleiter auf Augenhöhe sein. Da ist die Anschlussfähigkeit zum modernen systemischen Coaching offensichtlich.
Der Dialog der Seele mit sich selbst
Der Sprung in die Neuzeit zum französischen Philosophen Michel Foucault zeigt, wie der ursprüngliche Impuls der alten Griechen, Selbsterforschung und Selbstsorge, vom Katholizismus beschnitten und instrumentalisiert wurde. Die Konsequenz ist eine Entmündigung des Selbst: „Der entscheidende Gedanke ist, dass Platons innerer Dialog der Seele externalisiert wurde und der Dialogpartner (der Obere, der Abt) eine asymmetrische Beziehung zum sündigen Wahrheitssucher eingenommen hat“ (S. 11). Gegen die Beichtpraxis des Katholizismus haben Reformation und neuzeitliche Aufklärung die Autonomie des Individuums zum Glück wieder aufgewertet.
Fischer geht wieder zurück zu Platon und Sokrates. „Der Ursprung Sokratischer Erkenntnisbemühungen liegt in der Erkenntnis des eigenen Nicht-Wissens. Daraus leitet sich die Suche nach wahrer Erkenntnis ab. Geht es um das Selbst, dann erkennen wir, dass wir nicht wissen, wer und was wir sind. Alles Streben nach Selbsterkenntnis mündet in einen Suchprozess, der problematisch ist. Warum? Wenn wir nach etwas suchen, sollten wir wissen, wonach (was) wir suchen (…). Geht es allerdings um die Suche von etwas, das man (noch) gar nicht kennt, das unbekannt und unbestimmt ist, von dem man daher nicht weiß und nicht wissen kann, ob es das war, was man gesucht hat, wenn man es gefunden hat, landen wir in einer Paradoxie (…). Haben wir unser Selbst gefunden oder erfunden?!“ (S. 13).
An diesem Punkt liegt der Zünder blank und ungeschützt. Der philosophisch Vorgebildete erinnert sich, wie der ebenfalls französische Philosoph René Descartes in seinen „Meditationen“ seinerzeit an dieser Stelle einen vermeintlichen Ausweg fand: Cogito ergo sum. Diese Lösung stellte weder Religion noch kirchliche Obrigkeit in Frage, so dass Descartes auch den Kopf auf den Schultern behalten durfte. Doch der Nachwelt vermachte der Philosoph damit ein zwielichtiges Erbe.
Wer bin ich?
Es blieb nicht unkritisiert. Doch dauerte es Jahrhunderte, bis ein moderner Neurobiologe, Antonio Damásio (1994), sehr deutlich sagte: Hier irrte Descartes. Es verwundert, dass Fischer sich offenbar scheut, den sich aus heutiger Sicht zwingend anschließenden, radikalen Schritt zu gehen! Denn nimmt man ihn ernst, kann der Einzelne nicht sicher sein, sein „wahres“ Selbst zu finden. Vielleicht bildet man sich auch bloß etwas ein – oder lässt sich etwas einreden (Manipulation).
Dieser Verdacht ist aus moderner, neurobiologischer Perspektive betrachtet eben überhaupt nicht abwegig. Im Gegenteil! Mit Gerhard Roth, einem der angesehenen Kapazitäten seines Fachs, können wir sagen: „Das eigene Ich verflüchtigt sich, wenn man nach ihm sucht“ (Roth, 2008; S. 277). Der Grund liegt darin, dass die unbewussten Anteile unserer Existenz dem Bewusstsein nicht zugänglich sind. Was in der Großhirnrinde als bewusste Gefühle oder als Motive entsteht, sind bloß Interpretationen dieser Erregungen. Unser Unbewusstes, das blitzschnell entschieden hat, zwingt das Großhirn, nachträglich Sinn ins Handeln zu bringen – ohne über die wahren Beweggründe Bescheid zu wissen. Roth zitiert Gazzaniga: „Wir sind als bewusste Wesen die letzten, die mitkriegen, was mit uns los ist und uns treibt; wir sind wie Regierungssprecher, die Dinge rechtfertigen müssen, die sie gar nicht veranlasst oder getan haben“ (Roth, 2008; S. 289).
With a little help …
Der Coach als externe Instanz kann aber – wenn er geübt ist – über die vom Unbewussten stammenden Anteile unserer Kommunikation und unseres Verhaltens Zugriff zur unbewussten mittleren limbischen Ebene erlangen (Neurowissenschaftlich fundiertes Grundlagenwerk). Weil er nicht denselben blinden Fleck teilt. Das macht Coaching so potenziell wertvoll. Aber auch gefährlich, weil Scharlatane solches ausnützen können.
So bleibt Skepsis – und damit die Unruhe: Das Selbst will entwickelt werden. Das ist unser aller Lebensaufgabe. On the road again – unter Vagabunden.