INSPIRATION: Wird in zehn Jahren Künstliche Intelligenz die Weltherrschaft übernommen haben? Das kann man sich angesichts einer exponentiellen Entwicklung der Technologie einmal fragen. Die Antwort eines Experten ist erhellend.
Ralf Otte ist Professor an der Technischen Hochschule Ulm und arbeitet seit mehr als 30 Jahren auf dem Gebiet der KI. Seine Beiträge in der FAZ sind mir schon mehrfach positiv aufgefallen. Nicht nur, weil sie kritisch sind, sondern weil sie erhellend und tiefgründig sind. So auch dieser Beitrag (Die ultimativen Grenzen der Künstlichen Intelligenz).
Anzeige:

Heilsversprechen allerorten
Gleich zu Beginn schon gießt der Autor Wasser in den Wein der KI-Prediger, indem er auf das Thema autonomes Fahren zu sprechen kommt. Tja, so wirklich will es nicht funktionieren. Jedenfalls nicht zusammen mit der chaotischen Spezies Mensch im Straßenverkehr. Diese ist in ihrer Unberechenbarkeit der Algorithmus-Killer, wie wir schon früher gelesen haben (Und wer bringt den Müll raus?). „Auch Kraftwerke oder Flugzeuge werden nicht vollautonom mit KI gestartet oder heruntergefahren beziehungsweise gelandet. Dies wäre viel zu riskant.“
Vielleicht sollten Fabiola Gerpott und Stephan Jansen doch noch mal in sich gehen, wenn sie fordern, KI sollte die Führung im Unternehmen übernehmen, weil sie das besser könne als Menschen (Nix Pathie). Und der Einsatz von KI in der Kriegsführung? Autor Otte grinst: Dort sind „leider auch viel höhere Kollateralschäden ‚erlaubt‘“.
Viel zu viele Konjunktive
Jetzt mal Fakten: „KI ist laut der europäischen KI-Verordnung ein maschinengestütztes System, das ableiten (schlussfolgern) kann.“ Das nennt man Deduktion. KI kann aber heute mehr, auch Induktion, also vom Einzelfall generalisieren. Wir sprechen von maschinellem Lernen. Nichts Neues, so Autor Otte. In der Statistik gibt es seit mehr als 100 Jahren das Verfahren „multivariate Regression“. KI hat nun allerdings viel mehr PS …
Universelle Approximatoren, universelle Bildverarbeitungsmaschinen und nun auch noch universelle Sprachmaschinen. Vor Staunen bekommt „Klein Fritzchen“ heute den Mund nicht mehr zu. „Gibt es also in zehn Jahren Maschinen, die uns übertrumpfen, die dann gar die Weltherrschaft übernommen haben?“ Nein, lautet die klare Antwort von Autor Otte: „In zehn Jahren ist der gute Ruf der KI wahrscheinlich dahin. Warum?“
Ultimative Grenzen der KI
KI ist bloß eine Intelligenzsimulation
Viele verwechseln Simulation und Realität („The Map is not the Territory“). Das führt zwangsläufig in die Irre. Denn wir kennen die Grenzen der Simulation nicht. „Das Gehirn rechnet nicht, die KI rechnet immer“ (KI als Zombie). KI lernt, aber der Mensch lernt tausendfach effizienter. Das Verhältnis lautet: 1.000 zu 1. Ein drastisches Beispiel: „Ein Kind benötigt manchmal nur einen einzigen Datensatz, zum Beispiel eine heiße Herdplatte, um von dieser zu lernen, was Gefahr ist.“ KI braucht stattdessen menschliche Hilfe, um einigermaßen gut zu lernen (Gig-Work – eine Verzweiflungstat?).
Autor Otte dreht den Effizienzspieß einmal um: „In Europa bräuchte es wohl 100 neue Atomkraftwerke, wenn wir auf Level-4-Fahrzeuge [autonomes Fahren: Level 5 = Fahren ohne Lenkrad] umstellten.“ Viele tolle Ideen und KI-Versprechen werden niemals realisiert werden, weil es keine oder zu wenige Daten gibt, oder es zu teuer und zu aufwändig wäre, die tollen Ideen umzusetzen. – Mich erinnert das an die Diskussion um menschenleere, vollautomatische Fabrikhallen in den 1980er-Jahren. Wir werden sie auch in Zukunft wohl nicht bekommen. Das ist wohl auch besser so.
Das Halteproblem der Informatik
Das Unvollständigkeitstheorem des Mathematikers Kurt Gödel (1931) gilt auch in der Informatik. KI kommt mit Sätzen der Aussagenlogik gut zurecht: „Der Frosch ist grün.“ Mit der Prädikatenlogik erster Ordnung („alle“, „es gibt“, „niemand“) wird es schwierig für KI: Es könnte unendlich lange dauern, den Wahrheitsgehalt einer solchen Aussage in Echtzeit zu prüfen. Das kennen wir von Douglas Adams (Per Anhalter durch die Galaxis). Autor Otte: „Unendlich lange ist aber keine Option im Straßenverkehr.“
Mit der Prädikatenlogik zweiter Ordnung, unentscheidbaren Sätzen (einige Frösche können jede Farbe annehmen) oder der Selbstreferenz (Alle Kreter lügen, sagt der Kreter), kann KI gar nicht umgehen.
Ende Gelände
„Ethikdiskussionen wie ‚Sollte eine KI lügen, um Menschen zu schützen?‘ können die Ressourcen von KI vollständig erschöpfen, insbesondere, wenn man sie miteinander diskutieren ließe.“ Was die KI-Firmen gar nicht gerne sehen würden. Daher haben sie ihre Maschinen so programmiert, dass sie Paradoxien meiden und ihnen ausweichen.
„Sobald die Probleme komplexer werden, hat die KI auf Digitalcomputern ihre Grenze erreicht,“ so Autor Otte. „Es ist eine mathematische Grenze, die auch nicht mit noch mehr Technik und noch mehr Rechengeschwindigkeit überwunden werden kann.“
Digitaler Taylorismus
KI wird nicht weise werden, doch kann sie auch innerhalb dieser Grenzen extrem gefährlich werden. Stichwort: Digitaler Taylorismus (Wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt): „KI ist das ultimative Instrument der Überwachung von Prozessen und der Markierung von Anomalien jedweder Art. Das lässt sich kein Manager oder Politiker mehr entgehen“ (Wenn der Kopilot übernimmt …).




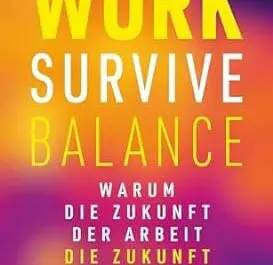
Eine Thema wird immer vergessen schützt KI unsere Natur? Unseren Lebensraum? Denke, die Frage ist beantwortet. Bis Dato klares NEIN.