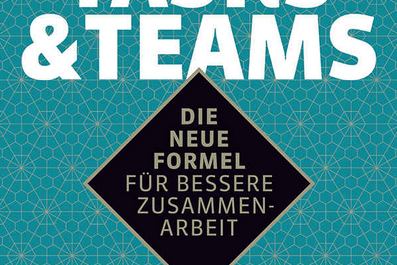KRITIK: Erinnert sich noch jemand an die „5. Disziplin“? Peter Senge (1990) hatte Personal Mastery, Mentale Modelle, gemeinsame Vision, Teamlernen und Systemdenken als die Faktoren organisationalen Lernens ausgemacht.
Doch irgendwie ist das Thema auf der Strecke geblieben. Klar, Life Long Learning will niemand mehr in Frage stellen. Doch wie emergiert das individuelle Lernen in ein organisationales? Sicher nicht, in dem die Personalentwicklung ein allgemeines Programm daraus macht. Inzwischen gibt es digitale Infrastrukturen des Lernens, ich sage mal: schön kleingehackt in Sushi-Größe, passend für die Mittagspause. Aber: Organisationales Lernen – wo bist Du? Gibt es denn eine Meta-Sushi-Theorie?
Anzeige:
 Die Arbeitswelt braucht agile Coachs, um Selbstorganisation, Innovation und neues Rollenverständnis zu implementieren. Die Neuerscheinung „Agiler Coach: Skills und Tools“ liefert für jeden agilen Coach eine beeindruckende Bandbreite an Grundlagen, Methoden und Werkzeugen für die Team- und Mitarbeiterentwicklung im agilen Arbeitsalltag. Zum Buch...
Die Arbeitswelt braucht agile Coachs, um Selbstorganisation, Innovation und neues Rollenverständnis zu implementieren. Die Neuerscheinung „Agiler Coach: Skills und Tools“ liefert für jeden agilen Coach eine beeindruckende Bandbreite an Grundlagen, Methoden und Werkzeugen für die Team- und Mitarbeiterentwicklung im agilen Arbeitsalltag. Zum Buch...
Auf die „5. Disziplin“ geht Autor Pätzold (Die übende Organisation) gar nicht erst ein. Die Geschichte hat ihm sozusagen recht gegeben: nichts gewesen außer Spesen (für die Sushi). „Organisationales Lernen kann als ein Prozess verstanden werden, der die Summe individueller Lernvorgänge überschreitet und letztlich etwas hiervon Unterscheidbares darstellt.“ Ja, genau, solche blumigen Sprüche kennen wir nur zu genüge, allein die Umsetzung … Ein erstes Aufhorchen: Autor Pätzold bemüht nicht Senge oder irgendwelche Epigonen, sondern die Autoren Haken sowie Schiersmann und Thiel. Das ist mal eine Ansage. Damit muss es um Lernen als einen synergetischen Prozess gehen.
Erfahrung
Erfahrung ist für Autor Pätzold eine zentrale Größe von Lernen. Das ist die Absage an die klassischen Lerntheorien psychologischer Art. Gut so! Erheben wir unseren Blick über das schnöde Niveau der Ratten hinaus: Lernen geschieht in Auseinandersetzung mit der Umwelt (Vielleicht sollte man einmal eine Ratte zum Thema interviewen). Es geht dabei nicht bloß um operantes Konditionieren; auch nicht um Lernen am Modell. Es geht um „Auseinandersetzung mit der Umwelt“. Und die Umwelt gibt Feedback. Man kommt ins Gespräch und kann damit arbeiten.
Und dieses Feedback ist nicht bloß ein rein kognitives (Winfried Hacker: Auge an Großhirn. Über die psychische Regulation von Tätigkeiten), sondern ein ganzkörperliches. Wir müssten über Embodiment (Die Rückkehr der Gefühle) sprechen! Leider geht Autor Pätzold darauf gar nicht ein. Da sehe ich noch deutlich Potenzial, den Ansatz noch qualitativ zu verbessern.
Pätzold: „Zum Lernen zugehörige Prozesse wie etwa die Auswahl von Information oder die Evaluation von Lernergebnissen.“ Und er geht noch einen entscheidenden Schritt weiter: All das lässt sich „auf der Organisationsebene beobachten“. Na also: Kybernetik 2. Ordnung. Und deshalb ist es wichtig informelles Lernen zu thematisieren – und zu beobachten (Es wird kein Manna regnen).
Doch hier hätte ich mir dann noch mehr vom Autor gewünscht: Zu hören, wie man dieses Beobachten professionell beobachten kann und muss. Und ich hätte gerne mehr über den genialen Kunstgriff des Experimentierens in diesem Zusammenhang gehört (Erlaubnis zum Experimentieren). Das hätte doch sowas von gepasst. Mensch …
Üben
Üben ist für Autor Pätzold eine Praxis, die auf ein Können ausgerichtet ist, ohne dass dieses Können bereits verfügbar ist. Es beruht wesentlich auf Wiederholung, ist aber nur begrenzt rationalisierbar und nicht zuletzt muss es deshalb praktisch ausgeübt werden. Das heißt:
- Üben ist Teil des Lernens: Es geht aber nicht bloß um stumpfe Wiederholung, sondern um aktive Auseinandersetzung mit dem Gegenstand.
- Es braucht Räume des Übens, Freiräume – und eine Fehlerkultur.
- Betriebliche Programme müssen es rahmen.
- Selbstorganisation: Der Lernende muss sein Lernen organisieren. Von außen kann nur begrenzt unterstützt und gesteuert werden. Wenn auch Angebote sinnvoll sind, Iteration aber ist das Programm.
Fazit
Endlich mal wieder ein tiefgründigerer Beitrag zum Thema Lernen. Man liest leider so wenig in dieser Richtung. Zuletzt war der Beitrag von Johanna Voigt und Julian Decius (KI und Lernen – ein Paradigmenwechsel?) erhellend. Das ist nun schon einige Zeit her. In der Zwischenzeit höre ich permanent die Botschaft, ich möge doch bitte das Denken an die KI abgeben (KI: Denken lassen oder selbst denken?).
Was ich bei Pätzold lese, ist ok. Aber mir fehlt noch die Vertiefung in Richtung Embodiment und in Richtung Experimentieren. Dann würde es sehr gut. Kann ja noch kommen …