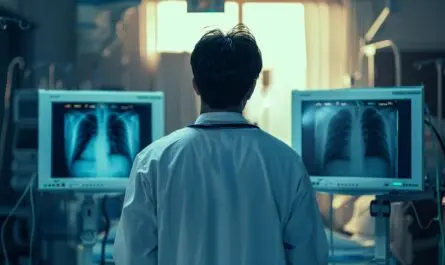INSPIRATION: KI greift optimierend in die Arbeitsorganisation ein. Das Ergebnis: Beschleunigung und Effizienz. Der Blick auf die psychischen Auswirkungen gibt jedoch allen Grund zur Sorge.
Müssen wir immer wieder dieselben Fehler machen? Lernen wir nicht dazu? Offensichtlich nicht. Oder nicht alle. Oder nicht das Richtige. Autor Jens Nachtwei (Algorithmisch geführt, psychisch gesund?) ist ein renommierter Arbeits- und Organisationspsychologe. Und er beschreibt, was leicht passiert, wenn man sich auf algorithmisches Management (AM) einlässt:
Anzeige:
Führung entwickeln. Teams stärken. Klar entscheiden.
Ich begleite Menschen & Organisationen in Veränderung – mit Coaching, Seminaren & Moderation.
👉 Mehr auf julia-engels.de

- Kontroll- und Autonomieverlust: Die Systeme entscheiden über den Kopf der Mitarbeitenden hinweg. Das führt zu Ohnmachtserfahrungen und Stress.
- Überwachung und Leistungsdruck: Alle wird getrackt, Big Brother lässt grüßen. Und die Mitarbeitenden fühlen sich wie am Fliegenfänger.
- Intransparenz und unklare Bewertungskriterien: Entscheidungen können nicht nachvollzogen werden, denn KI ist eine „Black Box“. Sie entzieht sich der Diskussion. Zurück bleiben frustrierte Mitarbeitende.
- Ständige Erreichbarkeit und schwindende Work-Life-Balance: Die Maschine wird nicht müde, aber Menschen. Stress und psychosomatische Krankheiten nehmen zu.
- Jobunsicherheit und fehlende soziale Unterstützung: Die Automatisierung ersetzt persönliche Kontakte. Vereinsamung führt zu Ängsten und existenziellen Sorgen.
Die Diagnose ist mitnichten neu
Sie zieht sich vom Aufstand der Weber, über die Bismarck’sche Sozialgesetzgebung und den Taylorismus bis in die Neuzeit hin und entfaltet seine totalitäre, toxische Wirkung heute unter dem Stichwort: Digitaler Taylorismus (Digitale Strippenzieher). Es ist eine Entwicklung, die mithilfe digitaler Kontrollmechanismen zurück zum Taylorismus will, sozusagen: Taylorismus 2.0. Davon träumte schon der olle Ford … Welcome to the machine!
Autor Nachtwei hat als Wissenschaftler auch gleich Daten zur Verbreitung von AM zur Hand. Desgleichen zu den Folgen für die Gesundheit als auch zur Bedeutung des Autonomieverlusts. Und die Sache ist klar: „AM verschlechtert das Wohlbefinden der Mitarbeiter“. Individuelle Anreize werden reduziert, finanzielle Unsicherheit wächst. Und noch eine Hiobsbotschaft: „In kleinen Unternehmen sind die negativen Auswirkungen von AM auf das Wohlbefinden am stärksten.“ Große Unternehmen bieten offensichtlich mehr Maßnahmen zur Unterstützung der Mitarbeitenden.
Die Aufgabe von HR
Jens Nachtwei kennt selbstverständlich das Arbeitsschutzgesetz, indem auch die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen implementiert ist (§ 5 ArbSchG). Daher verweist er auf Richtlinien, regelmäßige Audits oder die notwendige Einbindung von Beschäftigten. Er diktiert HR ins Pflichtenheft:
- Autonomie erhalten – durch hybride Entscheidungsmodelle. Algorithmen sollten nur als Unterstützungstools fungieren. Die Führungskraft trifft die finale Entscheidung – und bleibt verantwortlich.
- Transparenz erhöhen – mit erklärbaren Algorithmen. Es braucht klare und verständliche Richtlinien zur Funktionsweise von Algorithmen, Zugang der Mitarbeitenden zu Leistungsbewertungen und Entscheidungsparametern sowie regelmäßige Schulungen.
- Datenschutz und Fairness pflegen – Überwachung mit Augenmaß. Das Vertrauen der Belegschaft ist ein hohes Gut. Und deshalb werden auch Feedback- und Teilhabe-Mechanismen benötigt.
- Soziale Unterstützung stärken – Menschen sind keine Maschinen. Sie brauchen Teamspirit, Austausch und persönliche Wertschätzung.
- KI als Unterstützer nutzen – für psychische Gesundheit. Mittels ChatBots oder KI-gestützte Frühwarnsysteme.
- Nicht bloß Effizienz bewerten – gerechte Vergütungs- und Bewertungsmodelle: „Organisationen sollten Algorithmen regelmäßig auf Diskriminierungsfreiheit überprüfen, die Beteiligung der Belegschaft in Vergütungsfragen stärken und Incentive-Systeme entwickeln, die nicht nur quantitative, sondern auch qualitative Aspekte der Arbeit berücksichtigen.“
Förderliche Arbeitsgestaltung
„Entscheidend ist, dass Algorithmen den Menschen unterstützen – und nicht umgekehrt,“ so Autor Nachtwei und redet den HR-Professionals und dem Top-Management ins Gewissen. – Doch ich wundere mich: Die Rechtslage in Deutschland ist doch recht streng. Darauf weisen auch andere Experten immer wieder hin (Schlaraffenland ist abgebrannt). Da würde es mir als Führungskraft doch arg heiß unter den Füßen werden. Der Autor scheint da aber eher herumzutänzeln …
Doch dann konfrontiert mich der Autor noch mit folgenden Daten: „AM ist besonders in den USA (90 Prozent der Unternehmen) und Europa (79 Prozent) verbreitet, jedoch weniger in Japan (40 Prozent).“ Wie passt das zusammen? Sind hierzulande Betriebsräte und Arbeitsrichter etwa kettensägenmäßig entlassen worden? Habe ich irgendwas verpasst in den letzten Wochen?
Ich erinnere mich an die Kriterien förderlicher Arbeitsgestaltung nach Ulich: Ganzheitlichkeit, Anforderungsvielfalt, Möglichkeiten der sozialen Interaktion, Autonomie, Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten, Zeitelastizität und stressfreie Regulierbarkeit, Sinnhaftigkeit. Aus welchem fernen Lande, aus welcher vergangenen Zeit stammt dieses Echo? Ich habe das Gefühl, Autor Nachtwei schreibt doch recht zahm so vor sich hin … und denke mir: Wenn der Schwanz mit dem Hund wedelt …