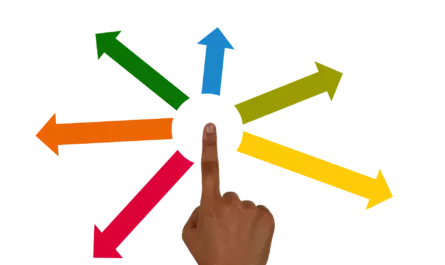INSPIRATION: Storytelling wird gerne manipulativ eingesetzt. Man möchte die Mitarbeitenden, die nicht so richtig mitziehen wollen, zum Jagen tragen. Es gäbe da noch einen anderen Weg als mit dem Kopf durch die Wand.
Warum das mit der Instrumentalisierung durch Storytelling nicht funktionieren kann, erläutert das Autorenpaar Christine Erlach und Michael Müller gleich zu Beginn des Interviews (Geronnene Erfahrung): „Unternehmenskultur [ist] die Summe aller Erzählungen […], die über ein Unternehmen intern oder extern erzählt werden.“ Wer da plötzlich eine andere Geschichte erzählen, den Mitarbeitenden überstülpen möchte, macht die Rechnung ohne den Wirt. Er gerät in Konflikt mit der Unternehmenskultur. Und die ist erzkonservativ, ein Produkt der Vergangenheit. Sie funktioniert wie das Immunsystem eines Unternehmens, so erkläre ich das immer: Was fremd ist und nicht passt, wird sogleich entdeckt und entsorgt. Und Tschüss!
Anzeige:
SOUVERÄN FÜHREN | FREUDE BEI DER ARBEIT | NACHHALTIGER ERFOLG. Mein individuelles Business Coaching entwickelt Ihre Führungskräfte gezielt: Klar werden für neue Denkansätze, Gelassenheit gewinnen, Herausforderungen bewältigen, überraschende Lösungen finden. Wie das geht? Warum mit mir? Erfahren Sie hier mehr …
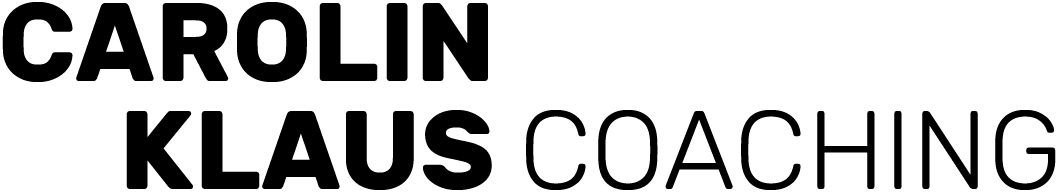
Die allzu forschen Unternehmenslenker und ihre smarten und dynamischen PR-Profis fahren den Change gegen die Wand. Denn die Mitarbeitenden riechen den Braten, denken sich ihren Teil, grinsen vielleicht noch – machen dann aber doch das, was sie immer gemacht haben. Oder – wenn man sie nötigt, das neue Lied zu singen, machen sie es halbherzig oder konterkarieren es sogar. Tja, Unternehmenskultur kann man nicht steuern. Das ist schon oft gesagt worden. Wenn es auch nicht jeder hören und beherzigen will.
Geschichten
„Im Mittelpunkt des übergeordnetes Organisationsnarrativs steht eine bestimmte Transformation. Man merkt das immer daran, wo die Leute anfangen, von früher und von heute zu erzählen.“ Mitarbeitende werden in diese Geschichte enkulturiert. Die Geschichte hat also Geschichte. Und diese lässt sich nicht ungeschehen machen. Die Menschen schildern (konstruieren) das Heute auf der Basis des Gestern. Kommt nun jemand daher und erzählt eine neue Geschichte, muss diese an der Vergangenheit anknüpfen können. Und zwar nicht simpel im Sinne eines „Reim‘ dich oder ich fress‘ dich“. Ein typischer Fehler, der auch oft bei der Arbeit mit Werten gemacht wird. Werte sind abstrakt. Jeder denkt sich etwas anderes dabei. Wenn es konkret werden soll, knirscht es dann oft im Gebälk: „Die kognitive Worthülse ist nicht lebendig.“
Storylistening vor Storytelling
Narrative müssen an den Erfahrungen der Beteiligten andocken können. Statt also mit der Tür ins Haus zu fallen, wäre der erste wichtige und notwendige Schritt: Zuhören! Vor dem Storytelling muss das Storylistening kommen. „Eine narrativ intelligente Organisation muss also Erzählräume schaffen, in denen die Mitarbeiter*innen ihre Erfahrungen teilen können, sie muss zuhören lernen.“ Mit dem Workshop-Format „Story Circle“, das die Autoren beschreiben, können die Erfahrungsgeschichten der Kolleg:innen gehoben werden. Die Methode erinnert an die Ethnografie oder an die qualitative Forschung mit Interviews. Die Narrative können für Kommunikations-, Change- oder Strategieprojekte nutzbar werden. Sie werden aber nicht überall passen, weil die Storyline natürlich eine spezielle ist, aus dem Kosmos der Erfahrungsgeschichten im Unternehmen stammt.
Lässt sich das alte Lied denn gar nicht verändern? Doch, sagen die Autoren, durch Storydoing. Damit ist gemeint, „die Rahmenbedingungen im Change so zu gestalten, dass neue Erfahrungen gemacht werden können“. Christine Grubendorfer hat das in ihrem Büchlein (Einführung in systemische Konzepte der Unternehmenskultur) schon schön beschrieben: Ändere Strukturen und Routinen. Das macht neue Erfahrungen möglich, die dann erzählt werden können. „Durch die neuen Erfahrungen ändert man den Geschichtskorpus“, sagen die Autoren Erlach und Müller. Vorausgesetzt, die neuen Erfahrungen sind anschlussfähig.
Das zeigt sich dann im Prozess des Teilens dieser Geschichten. Story-Co-Creation ist ein ernstgemeinter, partizipativer Prozess, in dem die Erzählgemeinde, also die Mitarbeiterinnen im Unternehmen, aber auch die Kunden, über diese Anschlussfähigkeit – und deren Tempo – entscheiden. Da wird sich dann zeigen, ob die tolle Super-Hero-Story passt. Oder als aufgesetzt, übergestülpt erlebt wird. Ein solcher Ansatz lehrt „Demut vor den Grenzen des Gestaltbaren“. Ich finde das definitiv sympathisch.
Change Story Canvas Board
Die Philosophie ist dieselbe, doch anregend und weiterführend finde ich die Zusammenfassung der Autorinnen (Change Story: Den Wandel greifbar machen) in der Zeitschrift changement. Die Canvas visualisiert die Schritte übersichtlich:
- Das Ziel
- Der Nutzen und die Zielgruppe
- Unsere Wurzeln
- Der Grund
- Die Veränderung
- Der eigene Beitrag
- Nächste Schritte